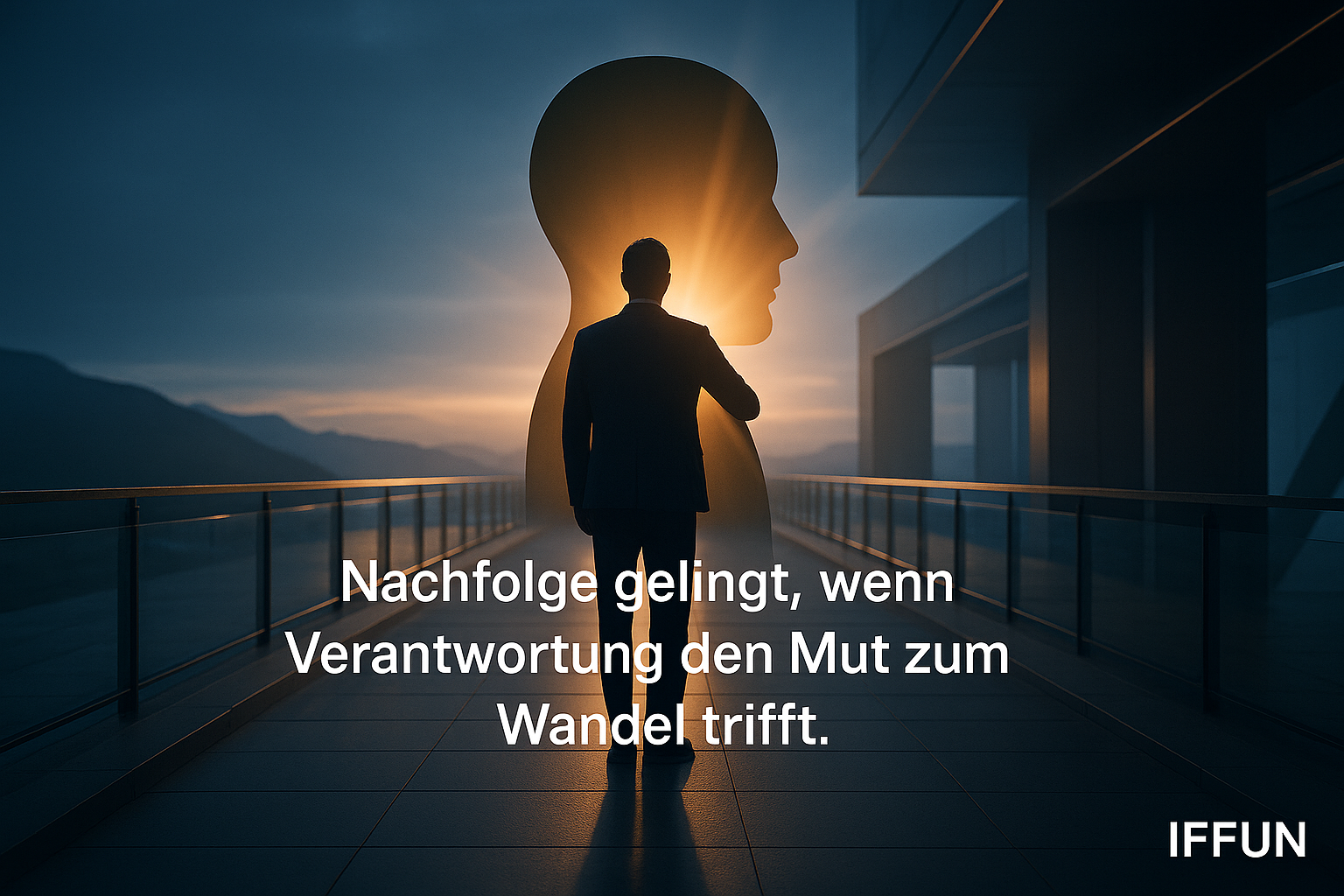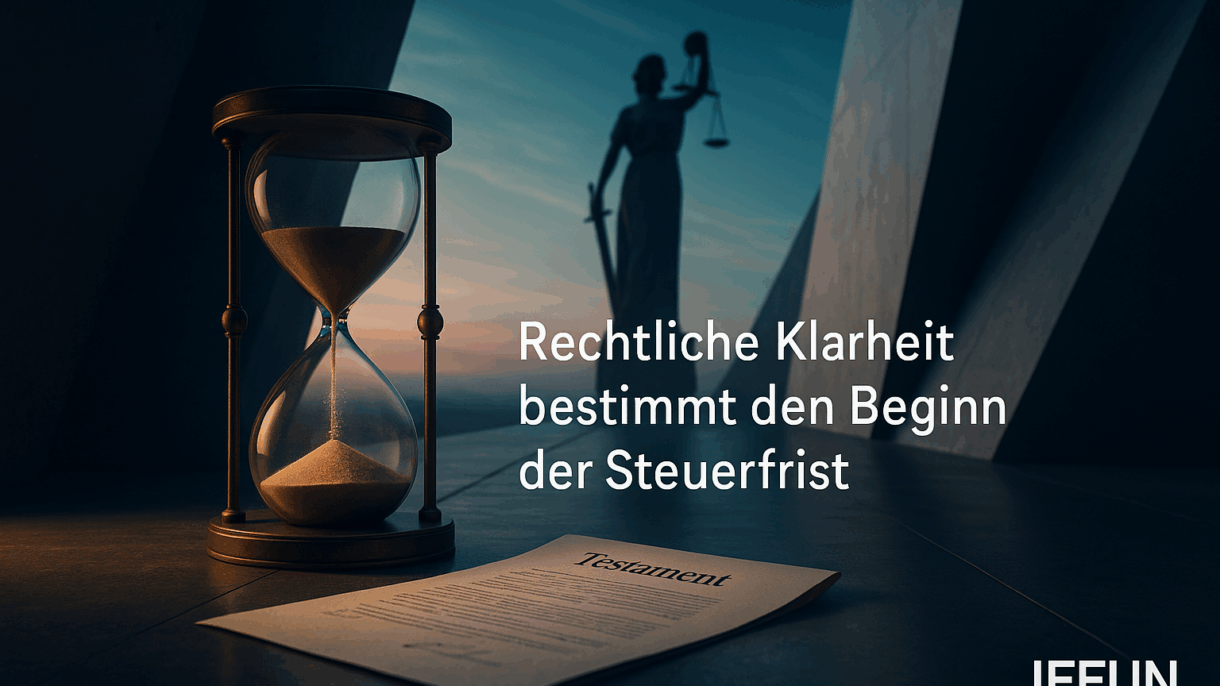
I. Bedeutung der Frist für steuerliche Nachfolgeplanung
Die Festsetzungsfrist gehört zu den zentralen Stellgrößen im Erbschaftsteuerrecht. Sie bestimmt, wie lange die Finanzverwaltung die Steuer für einen Erwerb von Todes wegen festsetzen darf. Nach Ablauf der Frist tritt Verjährung ein, und der Staat verliert seinen Anspruch auf Steuererhebung. Für Berater im Private Banking, in der Vermögensstrukturierung und der Nachfolgeplanung ist daher die präzise Kenntnis des Fristbeginns entscheidend, um steuerliche Risiken zu vermeiden und Fristversäumnisse auszuschließen.
Im praktischen Beratungsalltag führen gerade strittige Testamentssituationen regelmäßig zu Unsicherheiten: Wann beginnt die Frist tatsächlich, wenn ein Testament zunächst angefochten oder seine Wirksamkeit bestritten wird? Diese Frage hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 4. Juni 2025 (II R 28/22) grundlegend geklärt. Die Entscheidung präzisiert die Voraussetzungen, unter denen die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer zu laufen beginnt – und schafft damit erstmals eine einheitliche Grundlage für die steuerliche Behandlung komplexer Nachlassfälle.
II. Kernaussagen des BFH-Urteils
Der BFH hat in seinem Urteil entschieden, dass die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer erst dann zu laufen beginnt, wenn der Erwerber gesicherte Kenntnis von seiner rechtlich wirksamen Erbenstellung hat. Maßgeblich ist also nicht der bloße Umstand, dass ein Testament eröffnet wird, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Erbe weiß oder wissen muss, dass der Erwerb zivilrechtlich feststeht.
Gesicherte Kenntnis und Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO
Nach § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO beginnt die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer frühestens mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erwerber von dem Erwerb Kenntnis erlangt. Diese Kenntnis ist nach Auffassung des BFH nur dann gegeben, wenn der Erwerb auf einem bestimmten, rechtlich gesicherten Rechtsgrund beruht. Bei einem streitigen Testament ist dies regelmäßig erst der Fall, wenn das Nachlassgericht im Erbscheinsverfahren verbindlich über die Wirksamkeit des Testaments entschieden hat.
Damit stellt der BFH klar: Solange der Erbe keine verlässliche, rechtlich gesicherte Kenntnis über seine Erbenstellung hat – etwa weil ein anderer potenzieller Erbe Widerspruch eingelegt oder die Testierfähigkeit bestritten hat –, beginnt die Festsetzungsfrist nicht zu laufen. Erst die gerichtliche Feststellung im Erbscheinsverfahren löst den Fristbeginn aus.
Keine Verlängerung durch Anfechtbarkeit der Entscheidung
Bemerkenswert ist, dass der BFH ausdrücklich festhält: Die Möglichkeit eines Rechtsmittels oder eine tatsächlich eingelegte Beschwerde hemmt den Fristbeginn nicht. Es genügt, dass das Nachlassgericht entschieden hat und die Entscheidung dem Erben bekannt ist. Damit bleibt die steuerliche Frist unabhängig davon, ob die zivilrechtliche Entscheidung noch angefochten wird. Diese Klarstellung beseitigt die bis dahin verbreitete Unsicherheit, ob erst mit Rechtskraft des Erbscheins die Frist zu laufen beginnt.
Verbrauch der Anlaufhemmung pro Rechtsgrund
Die Anlaufhemmung gilt nach dem Urteil nur für den jeweiligen Rechtsgrund des Erwerbs. Wird später ein weiteres Testament gefunden, das einen neuen oder abweichenden Rechtsgrund begründet, beginnt für diesen Erwerb eine neue Festsetzungsfrist. Der BFH differenziert damit klar zwischen mehreren Erbgründen innerhalb desselben Nachlasses.
III. Steuerliche Praxisimplikationen
Das Urteil hat erhebliche praktische Konsequenzen für die steuerliche Nachfolgeplanung, insbesondere für die Fristberechnung, die Risikoabschätzung und die Dokumentationspflichten in komplexen Nachlasssituationen.
1. Auswirkungen auf den Fristlauf
Die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer beträgt nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO vier Jahre. Nach dem Urteil beginnt sie in Streitfällen erst mit dem Jahr, in dem die gerichtliche Entscheidung über die Wirksamkeit des Testaments ergeht. Dadurch können sich in der Praxis deutliche Verschiebungen ergeben. In Erbfällen mit jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen kann der Fristbeginn somit erheblich nach dem Tod des Erblassers liegen.
Für Berater bedeutet dies: Die steuerliche Risikoanalyse muss den Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis ausdrücklich berücksichtigen. Eine Fristberechnung allein auf Basis des Erbfalls oder der Testamentseröffnung ist unzureichend.
2. Bedeutung für Mitteilungs- und Anzeigeverpflichtungen
Nach § 30 ErbStG besteht für Erwerber eine Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten nach Kenntniserlangung vom Erwerb. Wird die Erbenstellung erst im Zuge eines gerichtlichen Verfahrens geklärt, beginnt auch diese Anzeigefrist erst mit dem Bekanntwerden der Entscheidung.
In der Beratungspraxis muss daher sichergestellt sein, dass Mandanten nach gerichtlicher Feststellung ihrer Erbenstellung die Anzeige fristgerecht vornehmen. Private-Banking-Abteilungen sollten entsprechende Compliance-Prozesse implementieren, um automatische Hinweise bei Nachlassentscheidungen zu generieren.
3. Nachweisführung und Dokumentation
Für die steuerliche Nachweisführung ist entscheidend, dass der Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis dokumentiert wird. Dies kann durch Vorlage des Erbscheins oder der gerichtlichen Entscheidung erfolgen. Die Finanzverwaltung wird voraussichtlich eine strenge Dokumentationspraxis verlangen, da sich durch den verschobenen Fristbeginn auch die steuerliche Verjährung verlängert.
4. Strategische Konsequenzen für Nachfolgeplaner
Aus Sicht der Nachfolgeplanung bietet das Urteil zugleich neue Gestaltungsspielräume. In komplexen Familienverhältnissen kann der Zeitpunkt des gesicherten Erwerbs steuerlich relevant sein, etwa für die Verknüpfung mit Freibeträgen oder die Bewertung von Vermögensgegenständen. Durch die spätere Feststellung des Erwerbs kann der Bewertungsstichtag nach § 11 ErbStG unter Umständen in ein Jahr mit günstigeren Vermögensverhältnissen fallen.
Für Berater ist es daher ratsam, in strittigen Fällen den Fortgang des Erbscheinsverfahrens eng zu begleiten und die steuerlichen Bewertungszeitpunkte in die Liquiditäts- und Nachfolgeplanung einzubeziehen.
IV. Praxisbeispiele aus der Beratung
Beispiel 1: Einzeltestament mit Anfechtung
Ein Erblasser setzt seine Tochter als Alleinerbin ein. Der Sohn fechtet das Testament wegen angeblicher Testierunfähigkeit an. Das Nachlassgericht entscheidet zwei Jahre später, dass das Testament wirksam ist. Erst mit dieser Entscheidung beginnt die Festsetzungsfrist für die Erbschaftsteuer. Die Anzeige- und Festsetzungsfristen verschieben sich entsprechend nach hinten.
Praxisbedeutung: Eine vorschnelle Steuererklärung vor Klärung der Erbenstellung ist nicht erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um Zinsrisiken zu vermeiden.
Beispiel 2: Zwei konkurrierende Testamente
Ein 2018 errichtetes Testament setzt den Neffen als Alleinerben ein, ein 2021 gefundenes Testament die Lebensgefährtin. Das Nachlassgericht entscheidet 2024 zugunsten des jüngeren Testaments. Für den Neffen beginnt die Festsetzungsfrist nie zu laufen, da sein Erwerb zivilrechtlich unwirksam ist. Für die Lebensgefährtin beginnt die Frist mit der gerichtlichen Entscheidung im Jahr 2024.
Beispiel 3: Erbengemeinschaft mit Testamentsvollstreckung
Mehrere Geschwister sind Erben. Der Testamentsvollstrecker wird erst drei Jahre nach dem Tod eingesetzt, nachdem die Gültigkeit des Testaments bestätigt wurde. Die Festsetzungsfrist beginnt für die Erben erst mit dieser Bestätigung. Ein bereits früher gezahlter Steuerbetrag kann bei späterer Ungültigkeitserklärung zu einer Erstattung führen.
Beispiel 4: Nachmeldung bei späterer gerichtlicher Klärung
Ein Bankberater erfährt, dass ein Mandant als Erbe in einem laufenden Nachlassverfahren benannt ist, das Testament aber angefochten wird. Er dokumentiert den Fall und weist auf die Pflicht zur Nachmeldung hin, sobald das Nachlassgericht entschieden hat. Damit wird das Risiko einer Anzeigepflichtverletzung vermieden.
Beispiel 5: Internationaler Nachlass
Bei einem in Spanien errichteten Testament mit deutschem Vermögen entscheidet das deutsche Nachlassgericht erst nach drei Jahren über die Anerkennung des Testaments. Auch hier beginnt die Festsetzungsfrist erst mit dieser Entscheidung. Die internationale Zuständigkeitsfrage ändert daran nichts.
V. Checkliste für die Beratungspraxis
Steuerliche Beratung bei strittigen Testamenten – zentrale Prüfschritte
| Prüffeld | Handlungsempfehlung | Ziel |
|---|---|---|
| 1. Analyse der Erblage | Prüfen, ob ein Testament, ein Erbvertrag oder mehrere Verfügungen vorliegen | Ermittlung der relevanten Rechtsgründe |
| 2. Prozessbeobachtung | Nachlassgerichtliche Verfahren aktiv verfolgen, Entscheidungen dokumentieren | Sicherstellung des Zeitpunkts der „gesicherten Kenntnis“ |
| 3. Anzeige nach § 30 ErbStG | Nach gerichtlicher Entscheidung unverzüglich innerhalb von drei Monaten anzeigen | Einhaltung der Anzeigepflicht |
| 4. Fristenmanagement | Beginn und Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 169 AO im Beratungssystem erfassen | Vermeidung von Fristversäumnissen |
| 5. Bewertungsstichtag prüfen | Vermögenswerte zum Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis neu bewerten | Optimierung der steuerlichen Bemessungsgrundlage |
| 6. Dokumentationspflichten | Erbschein, Beschluss und Mitteilungen des Nachlassgerichts archivieren | Nachweis gegenüber Finanzverwaltung sichern |
| 7. Abstimmung mit Steuerberater | Frühzeitige Einbindung des steuerlichen Beraters bei Fristberechnung | Konsistente Fristberechnung |
| 8. Kommunikation mit Mandanten | Klare Aufklärung über Fristbeginn und Anzeigepflichten | Haftungsminimierung und Compliance |
| 9. Interne Prozesse | Standardisierte Nachlass-Checklisten in Private Banking-Systemen hinterlegen | Automatisierte Risikokontrolle |
| 10. Nachverfolgung bei neuen Testamentsfunden | Bei neuem Rechtsgrund Frist neu berechnen | Sicherstellung richtiger Verjährungsbewertung |
VI. Fazit: Mehr Rechtssicherheit, aber erhöhte Verantwortung
Das Urteil des BFH II R 28/22 schafft dringend benötigte Klarheit über den Beginn der Festsetzungsfrist bei streitigen Testamenten. Es stellt die rechtliche Wirksamkeit des Erwerbs in den Mittelpunkt und entkoppelt die steuerliche Frist vom bloßen Erbfall. Für Berater im Private Banking und in der Nachfolgeplanung bedeutet dies zweierlei: einerseits mehr Rechtssicherheit in der Fristberechnung, andererseits eine erhöhte Verantwortung für das Fristen- und Dokumentationsmanagement.
Die Entscheidung macht deutlich, dass steuerliche Planung und zivilrechtliche Verfahren eng aufeinander abgestimmt werden müssen. Wer frühzeitig strukturiert dokumentiert, gerichtliche Entwicklungen überwacht und klare interne Prozesse etabliert, kann Mandanten zuverlässig vor steuerlichen Risiken schützen – und die Nachfolgeplanung rechtssicher begleiten.
Anhang A – Handlungsschritte für die Beratungspraxis
| Schritt | Maßnahme | Verantwortlich |
|---|---|---|
| 1 | Prüfung der Testamentslage und Erbenstellung | Nachfolgeplaner / Private-Banking-Berater |
| 2 | Erfassung des Todeszeitpunkts und möglicher Streitfragen | Berater |
| 3 | Einholung von Informationen zum Nachlassverfahren | Berater / Jurist |
| 4 | Dokumentation des Zeitpunkts der gerichtlichen Entscheidung | Berater |
| 5 | Fristberechnung nach § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO | Steuerberater |
| 6 | Erfüllung der Anzeige nach § 30 ErbStG | Erbe / Berater |
| 7 | Bewertung der Nachlasswerte zum maßgeblichen Zeitpunkt | Steuerberater |
| 8 | Archivierung der Unterlagen und gerichtlichen Beschlüsse | Compliance-Abteilung |
| 9 | Kommunikation mit Finanzamt und Mandant | Berater |
| 10 | Überprüfung auf neue Testamente oder spätere Rechtsänderungen | Nachfolgeplaner |
Anhang B – Rechtsquellen und Fundstellen
| Norm | Regelungsinhalt | Relevanz für Beratung |
|---|---|---|
| § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO | Beginn der Festsetzungsfrist bei Kenntnis vom Erwerb | Bestimmung des Fristbeginns |
| § 169 AO | Dauer der Festsetzungsfrist | Berechnung der Verjährung |
| § 30 ErbStG | Anzeigepflicht des Erwerbers | Pflichten bei Kenntnis des Erwerbs |
| § 9 ErbStG | Entstehung der Steuer | Verknüpfung von Erbfall und Erwerb |
| § 11 ErbStG | Bewertungsstichtag | Relevanz bei später Feststellung |
| §§ 2353 ff. BGB | Erbscheinsverfahren | Zivilrechtliche Grundlage der Entscheidung |
| BFH II R 28/22 (2025) | Beginn der Festsetzungsfrist bei strittigem Testament | Leitentscheidung 2025 |
| BFH II R 17/20 (2022) | Frühere Entscheidung zum gleichen Themenkreis | Bestätigung der Linie |
Anhang C – Zentrale Praxisimplikationen
| Thema | Bedeutung für die Praxis |
|---|---|
| Festsetzungsfrist | Beginn erst bei gesicherter Kenntnis der Erbenstellung |
| Rechtskraft | Nicht erforderlich für Fristbeginn |
| Mehrere Testamente | Getrennte Fristen je Rechtsgrund |
| Anzeigepflicht | Fristbeginn erst mit gerichtlicher Entscheidung |
| Bewertungsstichtag | Verschiebung kann steuerliche Vorteile bringen |
| Dokumentationspflicht | Nachweis der gerichtlichen Entscheidung entscheidend |
| Compliance | Pflicht zur strukturierten Prozessüberwachung |
| Haftungsrisiko | Falsche Fristberechnung kann zu Verjährungsverlust führen |