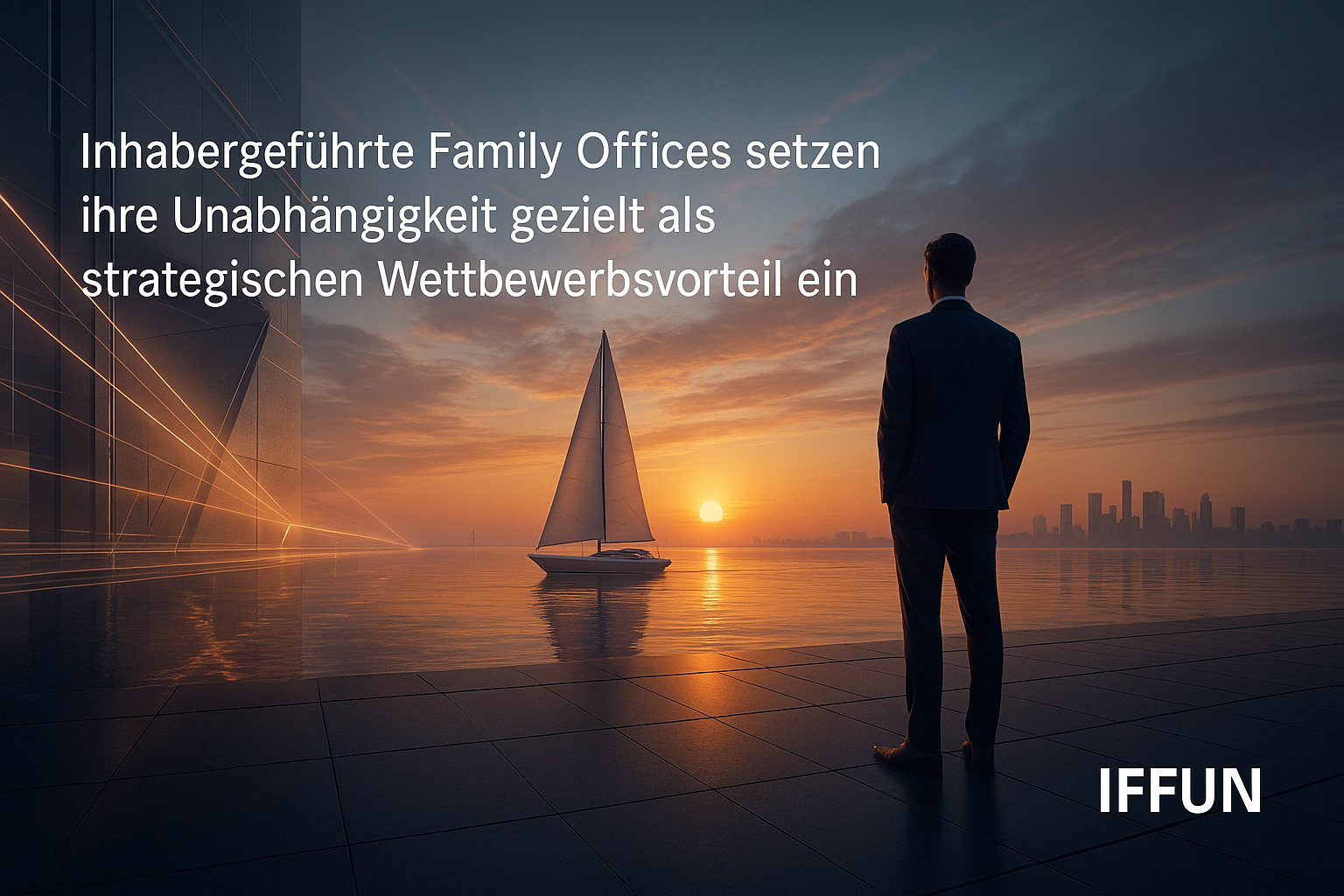Der Zugewinn ist ein zentraler Begriff im deutschen Ehegüterrecht und bezeichnet die Differenz zwischen dem Anfangsvermögen und dem Endvermögen eines Ehegatten während der Dauer einer Zugewinngemeinschaft. Er dient als Grundlage für den Zugewinnausgleich, der im Falle der Beendigung der Ehe – sei es durch Scheidung oder den Tod eines Ehepartners – ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung sind die Vorschriften der §§ 1373–1383 BGB.
Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand, der automatisch gilt, wenn Ehegatten keinen anderen Güterstand, etwa die Gütertrennung oder die Gütergemeinschaft, notariell vereinbaren. Der Zugewinn wird dabei für jeden Ehegatten einzeln berechnet: Das Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung gehört, während das Endvermögen den Stand zum Zeitpunkt der Beendigung des Güterstandes widerspiegelt. Die Differenz stellt den Zugewinn dar, wobei Schenkungen und Erbschaften nach § 1374 Abs. 2 BGB dem Anfangsvermögen zugerechnet werden.
Der Zugewinnausgleichsanspruch entsteht, wenn ein Ehegatte einen höheren Zugewinn als der andere erzielt hat. Nach § 1378 Abs. 1 BGB hat der Ehepartner mit dem geringeren Zugewinn einen Anspruch auf die Hälfte der Differenz. Dies dient dem Schutz des wirtschaftlich schwächeren Ehepartners und soll eine gerechte Vermögensaufteilung sicherstellen. Bei Beendigung des Güterstandes durch Tod des Ehegatten erfolgt eine pauschale Erhöhung des Erbteils um ein Viertel nach § 1371 Abs. 1 BGB, sofern kein Zugewinnausgleich durch Zahlung erfolgt.
In der Finanz- und Nachfolgeplanung spielt der Zugewinn eine bedeutende Rolle, insbesondere bei der Vermögensübertragung zwischen Ehepartnern. Eine geschickte Gestaltung kann dazu beitragen, steuerliche Belastungen zu minimieren und das Vermögen innerhalb der Familie zu optimieren. Die sogenannte Güterstandsschaukel, also der Wechsel zwischen Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung, wird oft gezielt genutzt, um Zugewinnausgleichsansprüche schenkungsteuerfrei zu realisieren.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der steuerlichen Behandlung des Zugewinnausgleichs. Während der Anspruch selbst keine Schenkung darstellt, kann die Art und Weise seiner Erfüllung steuerliche Folgen haben. Wird der Anspruch in Form von Sachwerten, beispielsweise Immobilien oder Unternehmensanteilen, beglichen, kann dies eine steuerpflichtige Veräußerung darstellen, insbesondere wenn stille Reserven aufgedeckt werden. Nach § 5 Abs. 2 ErbStG ist der Zugewinnausgleich bei Beendigung durch Tod schenkungsteuerfrei, während lebzeitige Regelungen einer sorgfältigen Gestaltung bedürfen.
Ein Praxisbeispiel zeigt die Bedeutung für die Nachfolgeplanung: Ein Ehepaar betreibt ein gemeinsames Unternehmen. Der Mann hat im Laufe der Ehe einen erheblichen Zugewinn erwirtschaftet. Um das Unternehmen steuerlich optimiert an die Frau zu übertragen, wird eine Güterstandsschaukel durchgeführt. Durch die Umstellung auf Gütertrennung wird eine Zugewinnausgleichsforderung ausgelöst, die in Form von Unternehmensanteilen beglichen wird. Da dies als entgeltliche Übertragung gilt, fällt keine Schenkungsteuer an, sofern keine stillen Reserven aufgedeckt werden.
In der Beratungspraxis ist es essenziell, den Zugewinnausgleich strategisch zu planen, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Hierbei spielen Eheverträge, steuerliche Gutachten und individuelle Vermögensaufstellungen eine zentrale Rolle. Nur durch eine frühzeitige Planung kann sichergestellt werden, dass Vermögen effizient und steueroptimiert zwischen Ehepartnern übertragen wird.