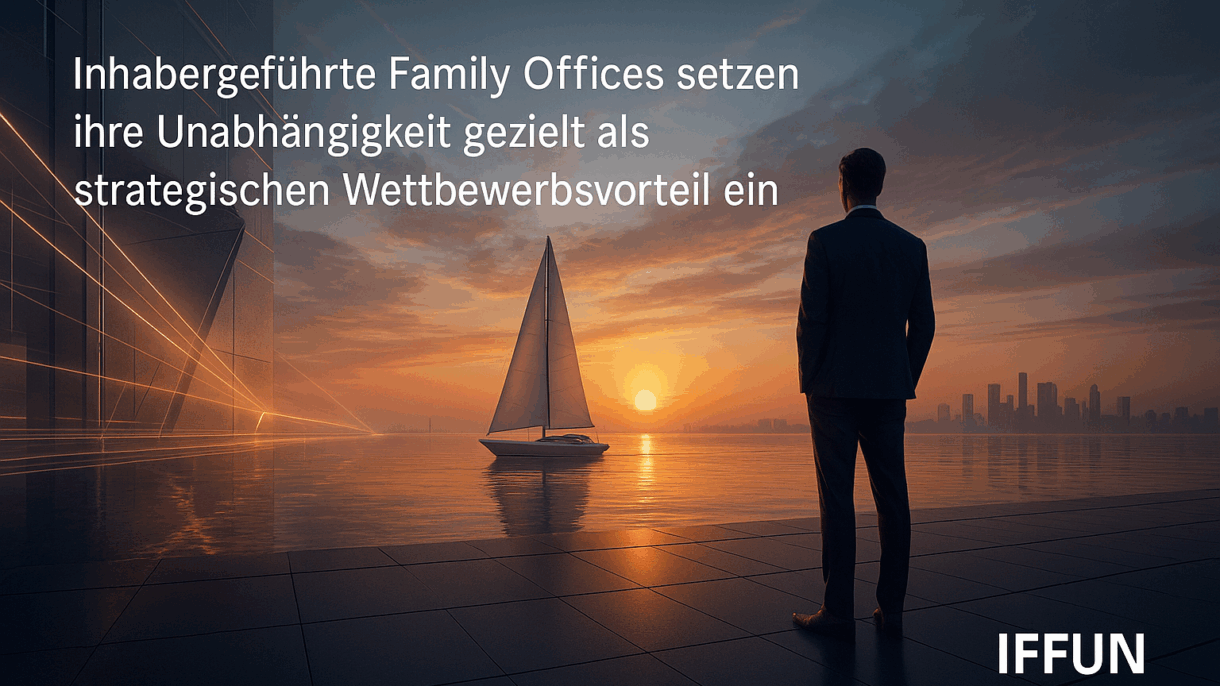
Inhabergeführte Family Offices setzen ihre Unabhängigkeit gezielt als strategischen Wettbewerbsvorteil ein und gestalten so die Neuausrichtung des deutschen Private-Wealth-Markts aktiv mit.
In Deutschland vollzieht sich eine strategische Neuausrichtung im Family-Office-Segment: Unabhängige, inhabergeführte Multi Family Offices setzen auf schlanke Governance, integrierte KVG-Strukturen und generational ausgerichtete Betreuung – exemplarisch gezeigt am Geschäftsmodell von Landsiedel & Partner.
1. Einleitung und Marktdynamik 2025
Die Welt des Private Wealth unterliegt derzeit tiefgreifenden Veränderungen: Regulatorische Anforderungen steigen, die Generationenübergabe in Unternehmer- und Familienvermögen wird zum zentralen Treiber, und der Wunsch nach maßgeschneiderter, langfristiger Betreuung rückt stärker in den Vordergrund. Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass das klassische Modell großer Bank- oder Konzern-Family-Office-Einheiten zunehmend hinter aktiven, eigenständigen Strukturen zurücktritt.
Wachstum und Struktur im Family-Office-Markt
Eine Studie zeigt, dass sich die Zahl der weltweiten Family Offices von 1.285 im Jahr 2019 auf 4.592 im Jahr 2023 mehr als verdreifacht hat. private banking magazin+2Data room dataroomX®+2 Für Deutschland wird geschätzt, dass zwischen 350 und 450 Single Family Offices bestehen. P&S Vermögensberatung+2INTES Akademie+2 Gleichzeitig lässt sich der Multi Family Office (MFO)-Sektor mit klarer Dienstleistungsorientierung in die Breite differenzieren.
Der globale Markt für Family Offices wird laut einer Prognose von 17,42 Mrd. US$ im Jahr 2023 auf 28,13 Mrd. US$ im Jahr 2031 anwachsen – bei einer CAGR von rund 6,2 %. The Insight Partners Zwar handelt es sich hierbei um globale Daten, doch sie verdeutlichen die Dynamik im Segment.
Treiber des Wandels
- Unabhängigkeit und Mandantenfokus: Vermögende Familien suchen verstärkt Dienstleister, die nicht primär einem Bank- oder Konzerninteresse verpflichtet sind, sondern ausgerichtet auf ihre spezifischen Bedürfnisse.
- Professionalisierung und Regulierung: Durch erhöhte Anforderungen an Governance, Transparenz, Reporting und Risikomanagement – etwa im Rahmen von KVG-Strukturen in Deutschland – steigen die Anforderungen an Family Offices.
- Generationenübergabe und Nachfolge: Viele Familien stehen vor dem Übergang des Vermögens in die nächste Generation, was neue Anforderungen an Struktur, Beratung und Steuerung mit sich bringt.
- Diversifikation der Anlagen und Asset-Klassen: Family Offices expandieren über traditionelle Anlageklassen hinaus – Immobilien, Private Equity, Private Debt, Liquidität – und verlangen dafür geeignete Organisations- und Serviceformen.
Die folgenden Kapitel beleuchten am Beispiel von Landsiedel & Partner, wie eine inhabergeführte Struktur unter diesen Bedingungen strategisch positioniert ist, welche strukturellen Konsequenzen sich daraus ergeben und welche Handlungsempfehlungen sich für Family Offices ergeben.
2. Das Modell Landsiedel & Partner: Struktur, Motivation, Differenzierung
Das Hamburger Multi Family Office Landsiedel & Partner wurde von Henning Landsiedel gemeinsam mit fünf erfahrenen Partnern gegründet – ein Schritt, der exemplarisch für die strategische Neuausrichtung im Markt steht.
Gründung und Hintergrund
Die Gründer – langjährig tätig bei einem bestehenden Anbieter – entschieden sich zur Ausgründung, nachdem die Internationalisierung und der vollständige Verkauf jenes Hauses ihre unternehmerische Gestaltungsfreiheit eingeschränkt hatten. Der Start erfolgte mit etwa 1,25 Milliarden Euro Assets under Management und zwei Familienmandaten. Parallel wird eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) aufgebaut, um auch institutionelle und bankseitige Mandate mit Immobilien-Dienstleistungen und skalierbaren Strukturen bedienen zu können.
Motivation und Partnerstruktur
Zentrale Motivationsfaktoren sind Unabhängigkeit, inhabergeführte Verantwortung und eine enge Verbindung zwischen Geschäftsführung und Anteilseignern. Nicht alle Partner sind gleichbeteiligt – Henning Landsiedel hält den stärksten Anteil, gefolgt von Jerome Roeschke und Ole Oelbüttel. Die übrigen Partner haben geringere Beteiligungen, was eine klare Führung und Ausrichtung erlaubt.
Das Team deckt sämtliche Kernbereiche eines Family Offices ab: neben Mandantenberatung (Ferdinand Delius) und Reporting (Beata Seweryn) sind Fonds- und Portfoliomanagement (Jerome Roeschke), Investmentmanagement (Ole Oelbüttel) und Risikomanagement (Johannes Kiefer) integriert.
Leistungsprofil und Differenzierung
Landsiedel & Partner betreut Vermögen über alle Asset-Klassen hinweg, mit einem natürlichen Schwerpunkt auf Immobilien – bedingt durch die Expertise von Ole Oelbüttel – und Aktivitäten in Private Equity, Private Debt sowie liquiden Assets. Ziel ist: ganzheitliche Betreuung inklusive Strukturierung, Investment-Zugang und individuellen Reporting-Lösungen.
Dies unterscheidet das Haus bewusst von großen internationalen Einrichtungen durch –
- kurze Entscheidungswege,
- persönliche Mandantenbeziehung,
- organisches Wachstum ohne externen Eigentümerdruck.
In einer Zeit, in der viele große Anbieter durch Teil- oder vollständige Integration in Bank- oder Konzernstrukturen Qualitätseinbußen bei Unabhängigkeit und Mandantenfokus sehen, setzt dieses Modell auf Konzentration auf den Mandanten und dessen individuelle Ziele.
3. Unabhängigkeit als strategischer Erfolgsfaktor
Unabhängigkeit gewinnt im Family-Office-Sektor zunehmend zentrale Bedeutung. Für Vermögensinhaber ist nicht nur die Expertise, sondern auch die Ownership-Struktur relevant: Wer trägt die eigene Verantwortung? Wer entscheidet? Wer ist Eigentümer und Dienstleister zugleich?
Entscheidungswege und Governance
Die inhabergeführte Struktur erlaubt bei Landsiedel & Partner, dass Entscheidungswege kurz sind und Eigentümer unmittelbar regulierend wirken können – ein Element, das großen, institutionellen Häusern häufig abgeht. Daraus ergeben sich Vorteile:
- schnellere Reaktion auf Mandantenbedürfnisse,
- geringere Interessenkonflikte (z. B. Produkt-Push vs. Mandanteninteresse),
- bessere Passung zwischen Dienstleister und Mandant.
Insbesondere im Kontext hoher Unsicherheiten in Finanz-, Immobilien- und Beteiligungsmärkten wird Flexibilität zum Wettbewerbsvorteil. So kann ein unabhängiges Haus Entscheidungen treffen, ohne externe Eigentümerinteressen oder Konzernvorgaben berücksichtigen zu müssen.
Eigentümer- und Beteiligungsstruktur
Nicht gleichbeteiligte Partner bedeuten bei Landsiedel & Partner, dass klare Führungsrollen und Verantwortlichkeiten definiert sind. Der größte Anteil liegt bei Landsiedel selbst, wodurch das strategische Steuerungszentrum homogen bleibt. Für Mandanten entsteht hier eine klare, nachvollziehbare Struktur.
Kosten- und Leistungsmodell
Unabhängigkeit ermöglicht zudem ein Geschäftsmodell ohne externe Eigentümerrendite oder Konzern-Überbau. Dies bietet Potenziale für Kosteneffizienz und Kundenorientierung. In einer Zeit steigender Reporting-, Governance- und Technologiekosten kann dieser Aspekt entscheidend sein.
Praxisbeispiel: Mandantenfokus
Beispielhaft zeigt sich dies in der Aussage von Landsiedel: „Unabhängigkeit ermöglicht volle Mandantenfokussierung und höchste Qualität.“ Im Markt, in dem zentrale Dienste oft ausgelagert und standardisiert sind, wird hier bewusst auf Individualität und Tiefe gesetzt.
Ein weiteres Beispiel: Beata Seweryn hebt das Thema digitale Prozesse und Mandantennähe hervor – ein Bereich, in dem viele größere Einheiten langsam reagieren.
Diese Elemente führen dazu, dass inhabergeführte Family Offices zunehmend als strategische Partner wahrgenommen werden, nicht nur als Vermögensverwalter. Insbesondere bei der Begleitung von Unternehmerfamilien über Generationen hinweg entsteht so ein „Haus für alle Themen“ – Vermögensverwaltung, Nachfolge, Reporting, Governance, Beteiligungen.
4. Regulatorik und KVG-Integration: Von der Pflicht zur Kür
Regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit zur Professionalisierung setzen Family Offices zunehmend unter Druck. Hier zeigt sich, wie inhabergeführte Strukturen die Regulierung nicht nur als Belastung, sondern als Chance nutzen können.
Gesetzlicher Rahmen
In Deutschland regelt das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zentrale Aspekte der Aufsicht über Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), Investmentfonds und damit verbundenen Tätigkeiten. Herfurtner Law Firm+1 Die deutsche Finanzaufsicht Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt die KVG-Tätigkeiten. BaFin+1 Im Umfeld von Family Offices gewinnt dabei insbesondere das Modell der eigenen KVG Bedeutung.
KVG-Struktur als strategisches Element
Landsiedel & Partner baut eine eigene KVG auf, um Immobiliendienste für Bankmandate zu professionalisieren und skalierbare Strukturen für institutionelle Investoren sowie andere Family Offices bereitzustellen. Diese Integration bietet mehrere Vorteile:
- Entfall eines externen Haftungsdachs und damit bessere Kosten- und Kontrollstruktur.
- Professionelle Prozesse, welche auch externen Anlegern offenstehen und somit Skalierung ermöglichen.
- Klar definierte Governance, Reporting und Risikomanagement – wichtige Faktoren, um Mandanten (und ggf. Familiennachfolger) das erforderliche Vertrauen zu bieten.
Damit wird Regulierung nicht nur als Compliance-Kostenfaktor gesehen, sondern als Möglichkeit zur Dienstleistungsdifferenzierung.
Marktumfeld und Entwicklungen
Die Nutzung der KVG-Struktur gewinnt im Markt an Bedeutung, nicht nur im institutionellen Segment. Dies eröffnet auch Family Offices Optionen zur Kooperation mit Banken oder anderen Family Offices. So weist ein Fachbeitrag darauf hin, dass der „Master-KVG“-Ansatz für deutsche institutionelle Investoren zunehmend eingesetzt wird. Simmons Simmons+1 Zudem warnt ein aktueller Artikel vor regulatorischer Verschärfung bei sogenannten „Special Funds“ durch die Aufsicht. Norton Rose Fulbright
Praxisbeispiel: Skalierung und Prozess-Digitalisierung
Das Geschäftsmodell von Landsiedel & Partner sieht vor, innerhalb des zweiten Geschäftsjahres profitabel zu werden und dabei auf digitale Prozesse und schlanke Governance zu setzen. Dies entspricht dem Trend, dass Family Offices zunehmend Teil von Infrastruktur- und Dienstleistungsplattformen werden – und damit weg vom klassischen „Vermögensverwaltungs-Silo“.
5. Marktvergleich und Zukunftstrends
Der Blick auf den Markt zeigt deutlich: Nicht alle Family Offices sind gleich. Unterschiede zwischen inhabergeführten, unabhängigen Anbietern und großen, institutionellen Einheiten werden markanter – mit entsprechenden Chancen und Risiken.
Inhabergeführte vs. institutionelle Modelle
- Inhabergeführte Family Offices zeichnen sich durch hohe Flexibilität, klare Governance-Struktur, oft geringere Hierarchien und stärkeren Mandantenfokus aus.
- Institutionelle oder banknahe Family Offices bieten häufig umfangreiche Infrastruktur, große Skaleneffekte und internationale Zugriffsmöglichkeiten – geraten jedoch bei individuellen Mandantenbedürfnissen oder Entscheidungsautonomie gelegentlich ins Hintertreffen.
Beispielsweise zeigt eine Übersicht zu deutschen Family Offices, dass viele große Häuser im Südwesten angesiedelt sind und zu den größten Mandaten gehören. private banking magazin+1 Zugleich weist eine Datenbank auf über 130 Multi Family Offices in Deutschland hin, die sich jeweils auf externe Familien spezialisiert haben. Listenchampion+1
Zukunftstrends
- Nachfolge und Generationenmanagement: Der Transfer von Vermögen und Verantwortung an nächste Generationen bringt neue Anforderungen an Struktur, Governance und Beratung.
- Technologisierung und Reporting: Digitale Prozesse, automatisiertes Reporting und erweiterte Risikomanagementtools werden zur Norm.
- Nachhaltigkeit und Impact Investing: Vermögensinhaber verlangen verstärkt nach Anlagekonzepten mit Wirkung – Family Offices müssen darauf reagieren.
- Direktinvestments und illiquide Klassen: Immobilien, Private Equity, Private Debt gewinnen weiter an Bedeutung; der Zugang und die Strukturierung werden entscheidend. Ein Beitrag weist darauf hin, dass gerade im Immobilien-Finanzierungsumfeld Family Offices zunehmend aktiv sind. Berenberg+1
- Skalierung und Plattformdenken: Familienvermögen wird nicht mehr nur intern verwaltet, sondern zunehmend über strukturierte Dienstleistungsangebote (z. B. eigene KVG) bereitgestellt.
Praxisbeispiel: Wachstum ohne externen Eigentümerdruck
Das Konzept von Landsiedel & Partner sieht bewusst organisches Wachstum vor – ohne externen Eigentümerdruck. Somit entsteht eine Unternehmens-DNA, die sich auf Individualität, Mandantenfokus und langfristige Orientierung konzentriert. In einem Markt, der von Veränderungen und Unsicherheit geprägt ist, wird diese Stoßrichtung zu einem klaren Differenzierungsmerkmal.
6. Fazit: Unternehmerische Freiheit als Wettbewerbsvorteil im Private-Wealth-Segment
Die strategische Neuausrichtung im deutschen Family-Office-Markt ist nicht nur eine Reaktion auf regulatorische oder marktseitige Anforderungen, sondern Ausdruck eines Paradigmenwechsels: Weg von standardisierten Angeboten, hin zu individualisierten, inhabergeführten Strukturen mit strategischer Nachhaltigkeit.
Am Beispiel von Landsiedel & Partner wird deutlich: Wenn Unabhängigkeit, Eigenverantwortung, skalierbare Governance und digitale Prozesse konsequent verbunden werden, entsteht ein Modell, das sowohl den Mandantenbedürfnissen als auch den Anforderungen des Marktes gerecht wird.
Für Family Offices bedeutet dies konkret: Wer seinen Mandanten heute einen ganzheitlichen, generationenübergreifenden Begleiter bieten will – inklusive Strukturierung, Investmentzugang, Nachfolgeberatung und Reporting – der sollte sich nicht primär über Größe definieren, sondern über Qualität, Entscheidungsfreiheit und Mandantenfokus.
Die inhabergeführte Struktur wird damit nicht nur zum Alleinstellungsmerkmal, sondern zum strategischen Erfolgsfaktor im Wettbewerb der Dienstleister im Private-Wealth-Segment.
Anhang A – Handlungsschritte für die strategische Neuausrichtung
| Schritt | Maßnahme | Verantwortlich |
|---|---|---|
| 1 | Analyse der aktuellen Eigentümer-, Beteiligungs- und Entscheidungsstruktur (z. B. Ausrichtung, Unabhängigkeitsgrad) | Geschäftsführung / Family Office Leitung |
| 2 | Definition des Leistungsprofils (Asset-Klassen, Mandantendefinition, digitale Prozesse) | Strategy/Investment |
| 3 | Aufbau oder Prüfung der Regulatorik- und Governance-Struktur (z. B. eigene KVG, Reporting, Risikomanagement) | Compliance/Risikomanagement |
| 4 | Mandanten- und Generationenmodell: Ausrichtung auf Nachfolge, Vermögensstrukturierung, Multi-Generationenbedürfnisse | Family Office Beratung |
| 5 | Digitalisierungs- und Kosteneffizienz-Check: Prozesse, IT, Datenqualität | Operations/IT |
| 6 | Markendifferenzierung: Positionierung als inhabergeführte, unabhängige Dienstleisterstruktur | Marketing/Sales |
| 7 | Wachstumskonzept organisch ohne externen Eigentümerdruck – inklusive Skalierungsstrategie über Plattform/Service | Geschäftsführung |
| 8 | Monitoring- und Controlling-Framework: KPIs für Mandantenzufriedenheit, Governance, Kosteneffizienz | Controlling |
| 9 | Evaluierung des Wettbewerbsumfelds: Vergleich andere Family Offices, Multi Family Offices, Banken-Modelle | Strategy |
| 10 | Umsetzung innerhalb definierter Zeitschiene (z. B. Ziel Profitabilität im Jahr 2) und regelmäßige Review-Zyklen | Geschäftsführung |
Anhang B – Rechtliche Quellen und Fundstellen
| Quelle | Thema | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) | Investmentfonds- und KVG-Regulierung | Zentralgesetz für deutsche KVG- und Fondsaufsicht. Herfurtner Law Firm+1 |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – Website | Beaufsichtigung KVG/Investmentfonds | Regulatorischer Rahmen für Asset-Management in Deutschland. BaFin+1 |
| Fachbericht „The German Master-KVG model“ | Struktur und Set-Up der Master-KVG | Darstellung der Master-KVG als Plattformmodell in Deutschland. Simmons Simmons |
| Studie „Zahl der Family Offices hat sich in vier Jahren verdreifacht“ Preqin | Wachstum Family-Office-Zahl | Datenbasis zur Marktgröße und Dynamik. private banking magazin |
| Datenbank family-office.de | Übersicht deutscher Multi Family Offices | Marktgrundlage für Dienstleistungsanbieter etc. family-office.de |
Anhang C – Zusammenfassung der wichtigsten Praxisimplikationen
- Die Entscheidung für eine inhabergeführte Struktur ist strategisch: Sie ermöglicht Flexibilität, Mandantenfokus und Unabhängigkeit.
- Die Integration einer KVG-Struktur bietet nicht nur regulatorische Absicherung, sondern eröffnet auch Skalierungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten.
- Kurzfristige Umsatz- oder AUM-Ziele sind weniger relevant als langfristige Mandantenbindung, Qualität und Entscheidungsfreiheit.
- Digitalisierte Prozesse, klares Reporting und Governance sind heute essenziell – nicht nur als Kostenfaktor, sondern als Mandantenmehrwert.
- Die Generationenübergabe erfordert frühzeitige Strukturierung: Ein Family Office muss neben Investitionen auch die Nachfolge, Governance und Familienkultur abbilden.
- Skalierung erfolgt nicht zwingend über Größe, sondern Qualität – z. B. durch offene Plattformansätze oder Dienstleistungsbündel, nicht durch reinen Asset-Zuwachs.
- Der Markt belohnt Differenzierung: Wer sich als unabhängiger, langfristiger Partner positioniert, gewinnt gegenüber standardisierten Angeboten großer Institute.




