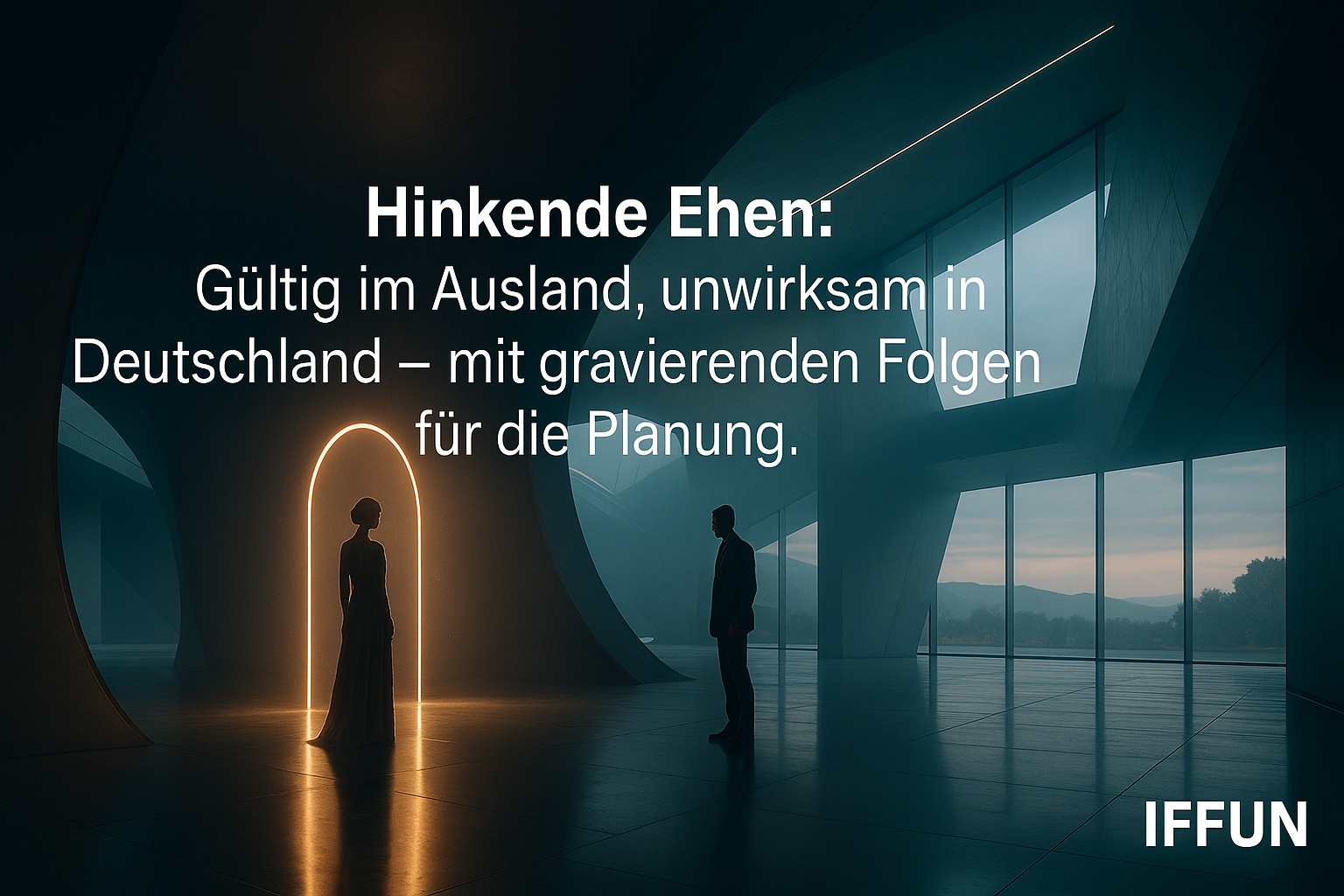5. August 2025
Eine Trennung bedeutet nicht nur emotionale Distanz, sondern oft auch die ganz praktische Frage: Wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung? Und wer muss gehen – ob freiwillig oder unfreiwillig? Für Finanz- und Nachfolgeplaner ist diese Frage weit mehr als ein logistisches Detail. Sie berührt Vermögenswerte, Nutzungskonzepte, Liquiditätsfragen – und kann zum Ausgangspunkt für künftige Konflikte oder strukturelle Lösungen werden.
Was ist die Ehewohnung – und warum ist sie so wichtig?
Die sogenannte Ehewohnung ist der Lebensmittelpunkt des Paares während der Ehezeit – unabhängig davon, wer im Mietvertrag steht oder im Grundbuch eingetragen ist. Sie umfasst nicht nur die Wohnung im engeren Sinn, sondern auch die gemeinsam genutzten Nebenräume, wie Keller, Garage oder Garten. Ob Eigentum oder Miete, ob geerbt oder gekauft: Entscheidend ist die tatsächliche Nutzung als gemeinsame Lebensbasis.
Warum ist das wichtig? Weil das Familienrecht davon ausgeht, dass die Ehewohnung eine besonders schützenswerte Funktion erfüllt – gerade in der Trennungszeit. Die Aufteilung dieser Räume ist daher nicht allein privatrechtlich zu lösen, sondern kann – wenn nötig – gerichtlich geregelt werden (§ 1361b BGB).
Wer darf bleiben – und zu welchen Bedingungen?
Im Trennungsjahr gilt: Die Ehepartner müssen nicht zwingend ausziehen. Auch eine Trennung innerhalb der Wohnung ist rechtlich möglich, sofern keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht. Kommt es jedoch zu Spannungen, stellt sich schnell die Frage nach der alleinigen Nutzung.
Rechtlicher Grundsatz:
Ein Ehegatte kann vom anderen die Überlassung der Ehewohnung (ganz oder teilweise) verlangen, wenn dies zur Vermeidung unzumutbarer Härte erforderlich ist. Das gilt insbesondere:
- wenn Kinder im Haushalt leben,
- wenn einer der Ehegatten besonders schutzbedürftig ist (z. B. gesundheitlich),
- oder wenn das Zusammenleben faktisch nicht mehr zumutbar ist (z. B. bei Gewalt, massiven Spannungen).
In der Praxis bedeutet das: Nicht automatisch der Eigentümer bleibt – sondern derjenige, für den das Verbleiben im Rahmen der Billigkeit erforderlich erscheint.
Sonderregel: „Schweigen heißt Zustimmung“
Zieht ein Ehegatte aus der Wohnung aus, ohne binnen sechs Monaten seine Rückkehr anzukündigen, entsteht eine rechtliche Vermutung:
Der Verbliebene darf die Wohnung weiterhin allein nutzen. Der Rückkehrwunsch verfällt – es sei denn, er wird rechtzeitig klar und ernsthaft erklärt.
Nutzung ≠ Eigentum: Die Rolle von Wohnwert und Vergütung
Ein häufiger Irrtum in der Beratung: Wer in der Wohnung bleibt, muss nichts zahlen.
Tatsächlich kann der ausgezogene Ehegatte eine Nutzungsvergütung verlangen – insbesondere dann, wenn er (mit-)Eigentümer ist oder die Finanzierung mitträgt.
Zwei typische Konstellationen:
- Mietwohnung auf beider Namen:
- Eigentumswohnung im gemeinsamen Besitz:
Diese Fragen sind besonders sensibel, da sie emotionale, finanzielle und juristische Aspekte gleichzeitig berühren.
Aufteilung des Hausrats: Was gehört wem?
Mit dem Auszug stellt sich oft auch die Frage: Wer bekommt den Fernseher, den Esstisch, die Waschmaschine?
Grundsätzlich gilt:
Haushaltsgegenstände, die dem gemeinsamen Gebrauch dienten, müssen fair aufgeteilt werden – unabhängig davon, wem sie gehören.
Nur wenn ein Gegenstand ausschließlich dem persönlichen Gebrauch eines Ehegatten diente (z. B. medizinisches Gerät, Arbeitsmittel), bleibt er bei diesem.
Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet auch hier das Familiengericht.
Relevanz für die Beratung: Wohnwert, Liquidität & Nachfolgeeffekte
Für Finanz- und Nachfolgeplaner ergeben sich aus dem Thema Ehewohnung mehrere praxisrelevante Handlungsebenen:
1. Bewertung der Immobilie
– Verkehrswert und Nutzungswert trennen
– Finanzierungsstruktur und Verbindlichkeiten analysieren
2. Liquiditätsplanung
– Auswirkungen auf Unterhalt, Miete, Kreditraten
– Absicherung bei Alleinnutzung (z. B. durch Wohnrecht oder Nießbrauch)
3. Gestaltung von Trennungsvereinbarungen
– Klarstellung der Nutzung
– Regelung der Vergütung und Eigentumsübergänge
– Vorbereitung auf den Zugewinnausgleich
4. Risikoabwägung bei dinglichen Rechten
– Wohnrecht, Erbbaurecht, Mitbenutzungsrechte
– Absicherung im Grundbuch prüfen
Gerade bei größeren Vermögenswerten oder Patchwork-Familienstrukturen ist die Frage „Wer bleibt wo – und zu welchen Bedingungen?“ ein zentraler Punkt jeder strategischen Trennungs- und Nachfolgeplanung.
Fazit: Die Ehewohnung ist mehr als ein Ort – sie ist ein Vermögensfaktor
Wer bei Trennung und Scheidung die emotionale von der wirtschaftlichen Ebene trennt, erkennt schnell:
Die Nutzung und Bewertung der Ehewohnung ist kein Nebenschauplatz, sondern ein strategischer Kernpunkt.
Für Berater bedeutet das:
Nicht nur vermittelnd auftreten – sondern strukturiert bewerten, realistisch planen und klar kommunizieren.
So entsteht aus Trennung kein Chaos – sondern Klarheit.
In der nächsten Folge unserer Serie:
„Hausrat, Konto, Vollmacht – Was bei der Vermögensaufteilung im Trennungsjahr zu beachten ist.“