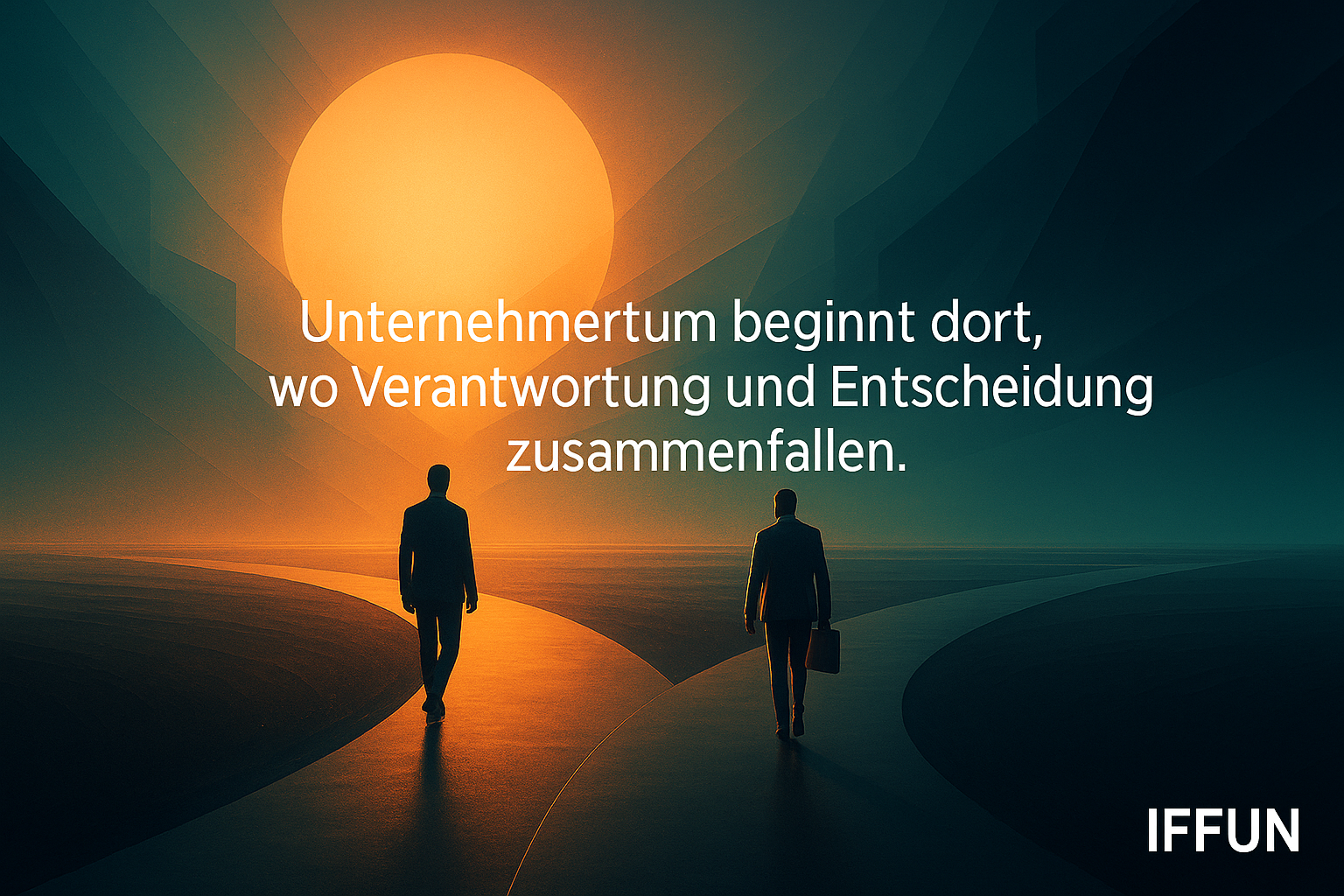Einleitung: Trügerische Rekorde in unsicheren Zeiten
Die Deutschen verfügen über ein historisch hohes Geldvermögen. Zum Ende des ersten Quartals 2025 meldet die Deutsche Bundesbank eine Gesamtsumme von 9.053 Milliarden Euro auf den Konten der privaten Haushalte – ein neuer Höchststand. Doch diese Zahl trügt. Denn hinter dem Rekord steht ein wachsendes Problem: Die reale Rendite – also der Vermögenszuwachs nach Abzug der Inflation – liegt für breite Bevölkerungsschichten unter einem Prozent.
Für professionelle Finanz- und Nachfolgeplaner ergibt sich hieraus eine doppelte Herausforderung: Vermögensstruktur und Anlageverhalten neu zu analysieren sowie mit Blick auf wirtschaftliche Unsicherheit und regulatorische Anforderungen tragfähige Finanzpläne zu entwickeln.
1. Vermögensstruktur im Wandel: Liquidität dominiert Substanz
1.1. Sichteinlagen als dominanter Vermögensbaustein
Laut Bundesbank entfällt mit 37 % der größte Teil des Brutto-Geldvermögens auf Bargeld und Sichteinlagen. Dieser Anteil hat sich in den letzten fünf Jahren signifikant erhöht – insbesondere durch Umschichtungen aus Festgeld infolge der Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank.
Für vermögensschwächere Haushalte sind kurzfristig verfügbare Mittel vor allem psychologisch attraktiv. Doch sie bringen faktisch kaum Erträge. Die reale Verzinsung – inflationsbereinigt – liegt laut aktueller Analyse des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) sogar im negativen Bereich (Stand: Q2/2025).
1.2. Versicherungen und Fonds: Trägheit trotz Potenzial
Knapp 28 % der Vermögenswerte entfallen auf Versicherungsansprüche und betriebliche Altersvorsorgeverträge. Weitere 13 % liegen in Investmentfonds – meist breit gestreut, jedoch oft mit unklarer Risikostruktur für den Anleger. Nur rund 20 % entfallen direkt auf Aktieninvestments.
Der Unterschied in der Vermögensentwicklung ist beachtlich: Während Aktienanleger in den Jahren 2020–2024 durchschnittliche Kursgewinne von jährlich über 6,5 % erzielen konnten, verloren Bankeinlagen im selben Zeitraum real an Wert.
2. Die Vermögensschere öffnet sich weiter: Ursachen und Dynamiken
2.1. Wer profitiert – und wer verliert?
Nach Angaben der Bundesbank besitzen die vermögendsten 10 % der Haushalte über 50 % des gesamten Geldvermögens. Deren Portfolios bestehen zu einem erheblichen Teil aus renditestarken Anlagen wie Aktien, Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien – und sie profitieren stärker von der wirtschaftlichen Entwicklung.
Die unteren 50 % hingegen halten ihr Vermögen fast vollständig in risikoarmen Anlagen. Damit wächst die Vermögensschere nicht nur durch Einkommen, sondern auch durch Strukturentscheidungen beim Kapital.
2.2. Fallstudie: Vermögensentwicklung im Vergleich
| Haushaltstyp | Vermögen 2020 | Anlageform | Ø-Jahresrendite | Vermögen 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Akademiker (45 J., 2 Kinder) | 450.000 € | 60 % ETF, 30 % Rücklagen, 10 % Beteiligungen | 5,4 % | 586.000 € |
| Angestellter (35 J., alleinlebend) | 60.000 € | 90 % Tagesgeld, 10 % Riester | –0,2 % | 59.400 € |
| Unternehmer (63 J., Betriebsverkäufer) | 3 Mio. € | 20 % Aktien, 20 % Immobilienfonds, 40 % Holding, 20 % Versicherung | 4,8 % | 3,800 Mio. € |
3. Die Rolle der Finanzplanung: Von Liquidität zur Strategie
3.1. Fehlendes Know-how führt zu Kapitalfehlsteuerung
Viele Haushalte verbinden mit dem Begriff „Sicherheit“ nach wie vor Sparbuch, Tagesgeld oder Lebensversicherung – nicht Diversifikation oder strategische Allokation. Die zentrale Rolle der Finanzplanung besteht darin, diese semantische Verzerrung aufzulösen und über systematische Risikoanalyse zur bewussten Portfoliostrukturierung zu führen.
3.2. Regulatorische Aspekte: Geeignetheit, Nachhaltigkeit und Offenlegung
Berater müssen heute neben finanzieller Aufklärung auch regulatorischen Anforderungen gerecht werden:
- § 64 WpHG (Geeignetheitsprüfung)
- Offenlegungsverordnung (SFDR) bei nachhaltigen Investments
- MiFID II-konforme Dokumentation
Verstöße gegen diese Pflichten können nicht nur Haftungsrisiken begründen, sondern auch gravierende Reputationsschäden verursachen.
4. Handlungserfordernisse für Berater: Strategische Reallokation
4.1. Professionelle Allokation unter Berücksichtigung von Risikoneigung
Eine fundierte Vermögensstruktur basiert auf dem individuellen Risiko-Rendite-Profil des Mandanten. Dabei gilt:
- Liquidität ja – aber strategisch begrenzt
- Sicherheit durch Absicherung, nicht durch Kapitalstillstand
- Rendite durch Diversifikation, nicht durch Prognoseglück
4.2. Best-Practice: Strategiewechsel eines mittelständischen Ehepaares
Ein Ehepaar (beide 50, Einkommen 180.000 €/Jahr, Vermögen 800.000 €) lagerte 75 % des Vermögens in Versicherungsprodukten. Nach struktureller Finanzplanung (Cashflow-Analyse, Zielabgleich, Risikoprofil) erfolgte eine Reallokation zu 30 % ETF-basiert, 20 % Rücklagen, 15 % alternative Anlagen, 35 % steueroptimierter Versicherungslösung. Prognostizierter Renditezuwachs: +1,8 % p.a. real.
5. Psychologie und Beratungskultur: Der Schlüssel zur Umsetzung
5.1. Verhaltensökonomie ernst nehmen
Beraterinnen und Berater müssen emotionale Barrieren erkennen und adressieren:
- Verlustaversion
- Status-quo-Verzerrung
- Informationsüberlastung
5.2. Beraterhaltung: Von Produktempfehlung zur Prozesskompetenz
Mandanten erwarten heute keine Produktvergleiche – sie erwarten Orientierung.
Finanzplanung ist Beziehungsarbeit. Und diese muss strukturiert, nachvollziehbar und proaktiv erfolgen.
6. Fazit: Sicherheit entsteht durch Planung – nicht durch Vermeidung
Das historische Geldvermögen der Deutschen ist kein Garant für Sicherheit. Im Gegenteil: Die falsche Struktur kann zu realem Wertverlust führen – und langfristig die Vorsorge gefährden.
Professionelle Finanz- und Nachfolgeplanung beginnt dort, wo Statistik endet: bei der Struktur, den Zielen und der Lebensrealität des Einzelnen.
Nur wer versteht, wie Rendite, Risiko und Liquidität zusammenspielen, kann nachhaltig planen. Und nur wer plant, schafft echte Sicherheit – heute wie morgen.
Anhang A: Handlungsschritte für Finanz- und Nachfolgeplaner
| Handlungsschritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Analyse der aktuellen Vermögensstruktur (Liquidität, Bindung, Risiko) |
| 2 | Ermittlung der realen Rendite (nach Inflation) |
| 3 | Zieldefinition des Mandanten (Zeithorizont, Ziele, Abhängigkeiten) |
| 4 | Erfassung der regulatorischen Rahmenbedingungen (MiFID II, SFDR) |
| 5 | Erstellung eines strategischen Reallokationsplans |
| 6 | Aufklärung zu Renditequellen und Risikoprofilen |
| 7 | Implementierung von nachhaltigen Vermögensbausteinen |
| 8 | Dokumentation und Reporting (geeignet für BaFin-/WpHG-Anforderungen) |
| 9 | Regelmäßiges Monitoring & Nachjustierung |
| 10 | Kommunikation mit Nachfolgeplan in Einklang bringen |
Anhang B: Rechtliche Quellen und Fundstellen
| Rechtsquelle | Relevanz | Fundstelle |
|---|---|---|
| § 64 WpHG | Geeignetheitsprüfung bei Anlageberatung | www.gesetze-im-internet.de/wphg/__64.html |
| MiFID II | Anforderungen an Beratungsdokumentation | EU-Richtlinie 2014/65/EU |
| SFDR | Offenlegung nachhaltiger Anlagen | EU 2019/2088 |
| BGH-Urteil vom 6.7.2021 (XI ZR 271/20) | Beratungspflichten bei Provisionsmodellen | juris.de |
| BaFin-Merkblatt zur Finanzportfolioverwaltung (2023) | Anforderungen an Vermögensstrukturierung | www.bafin.de |
Anhang C: Praxisimplikationen
- Liquidität ist kein Selbstzweck – sondern Teil einer übergeordneten Struktur.
- Reale Rendite muss nach Inflation bewertet werden, nicht nur nominal.
- Vermögenspsychologie entscheidet über Umsetzung – nicht Rechenmodelle.
- Finanzplanung ist ein regulatorisch geprägter Prozess, kein „Beratungsgespräch“.
- Nur durch eine klare Strukturierung entsteht generationenübergreifende Stabilität.