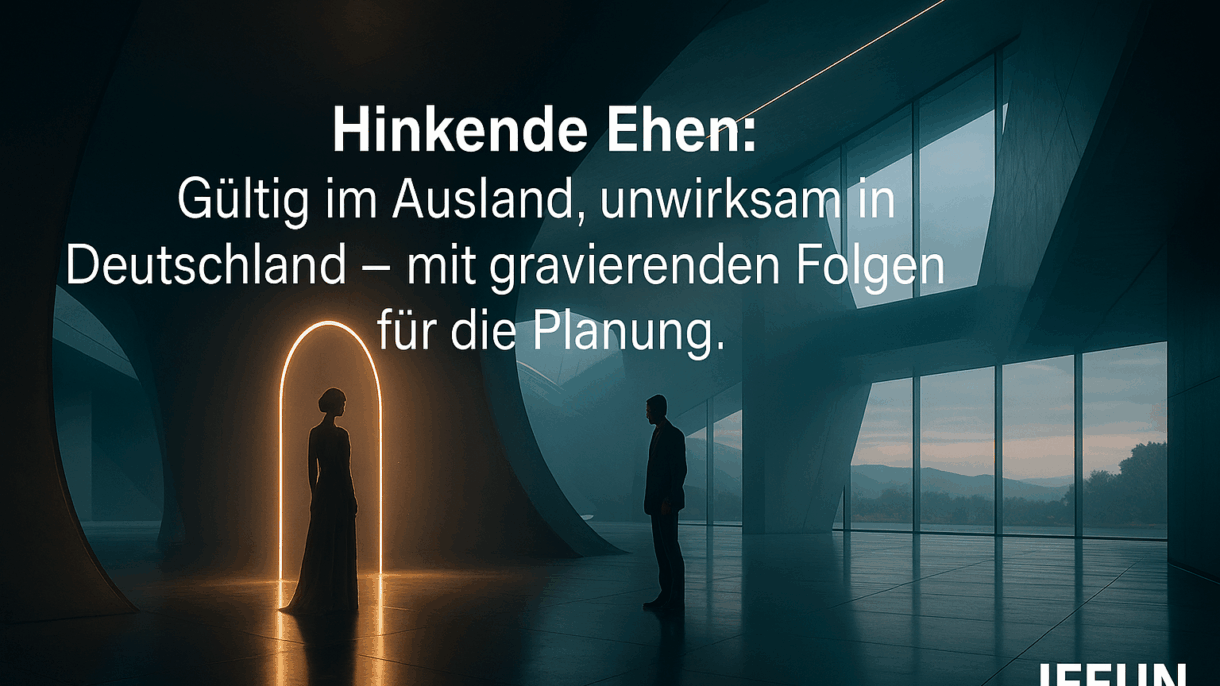
Internationale Eheschließungen eröffnen vielfältige Chancen, gerade bei grenzüberschreitender Vermögens- und Nachfolgeplanung. Gleichzeitig bergen sie erhebliche rechtliche Risiken, wenn es sich um eine sogenannte „hinkende Ehe“ handelt – also eine Ehe, die in einem Staat als gültig gilt, in einem anderen jedoch nicht anerkannt wird.
Für Finanz- und Nachfolgeplaner ist dieses Phänomen weit mehr als eine juristische Kuriosität: Es berührt zentrale Fragen von Erbrecht, Unterhalt, Zugewinnausgleich, Versorgung und Aufenthaltsrecht. Ziel ist, die relevanten Fallkonstellationen zu kennen, ihre Folgen zu verstehen und daraus belastbare Gestaltungslösungen abzuleiten.
Praxisbeispiele hinkender Ehen
Beispiel 1: Formunwirksame Eheschließung
Ein Paar heiratet im Ausland nach dortigem Recht, doch die Form genügt nicht den Anforderungen in Deutschland. Ergebnis: Die Ehe wird hier nicht anerkannt – Unterhalts- oder Erbansprüche bestehen nicht.
Beispiel 2: Frühehe
Eine Ehe wird im Ausland mit einer unter 16-jährigen Person geschlossen. Während sie im Herkunftsland gilt, ist sie in Deutschland automatisch unwirksam.
Beispiel 3: Bigamie-Risiko
Ein Ehepartner ist im Ausland bereits verheiratet, diese Ehe gilt in Deutschland jedoch nicht. Wird hier eine neue Ehe geschlossen, kann dies im Herkunftsland als Bigamie gewertet werden.
Beispiel 4: Polygame Ehen
Mehrfach-Ehen sind in Deutschland grundsätzlich verboten, können jedoch im Herkunftsland fortbestehen. Daraus ergeben sich komplexe Fragen zu Unterhalt, Erbfolge und Vermögenszuordnung.
Beispiel 5: Abweichende Scheidungsregelungen
Ein Staat erkennt eine Scheidung nicht an, die in Deutschland wirksam ist. Für die Betroffenen kann dies zu widersprüchlichen Rechtsfolgen führen.
Rechtliche Grundlagen (Stand 2024/2025)
Begriff und Abgrenzung
Eine „hinkende Ehe“ liegt vor, wenn dieselbe Ehe in verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich bewertet wird – gültig im einen, unwirksam im anderen Staat.
Ordre public
Ehen, die gegen grundlegende Wertvorstellungen des deutschen Rechts verstoßen, werden nicht anerkannt – etwa bei Zwangs- oder Kinderehen.
Frühehenregelung
Seit 2017 sind Ehen mit unter 16-jährigen Personen in Deutschland automatisch unwirksam, unabhängig von der Rechtslage im Herkunftsstaat.
Güterrechtsordnung
Bei grenzüberschreitenden Ehen gilt vorrangig das durch Rechtswahl oder gewöhnlichen Aufenthalt bestimmte Recht für den Güterstand. Die Anerkennung der Ehe ist hierfür entscheidend.
Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis
Frühzeitige Prüfung: Herkunftsrecht, Eheschließungsform und Ehemündigkeit vor einer geplanten Gestaltung klären.
Lückenlose Dokumentation: Heiratsurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse und gegebenenfalls Rechtsgutachten sichern.
Gestaltungsalternativen: Testament, Erbvertrag, Unterhaltsvereinbarung oder Gütertrennung als Absicherung.
Erbstatus klären: Prüfen, ob der Partner im Inland als Ehegatte gilt, um Erbfolgekonflikte zu vermeiden.
Aufenthaltsrecht prüfen: Unklare Ehen können den Aufenthaltstitel gefährden.
Risikovermeidung: Bigamie-Vorwürfe oder widersprüchliche Rechtsfolgen bei erneuter Eheschließung ausschließen.
Rechtslage beobachten: Änderungen im internationalen Privatrecht und bei EU-Regelungen fortlaufend verfolgen.
Compliance sicherstellen: Melde- und Anzeigepflichten gegenüber Behörden einhalten.
Fazit
Hinkende Ehen sind ein rechtliches Minenfeld für alle, die in der Finanz- und Nachfolgeplanung mit internationalen Bezügen arbeiten. Ohne sorgfältige Prüfung drohen gravierende Folgen – vom Verlust erbrechtlicher Ansprüche bis zu aufenthaltsrechtlichen Problemen. Eine präzise Analyse, vorausschauende Gestaltung und konsequente Dokumentation sind daher unverzichtbar.
Anhang A – Tabelle „Handlungsschritte“
Nr. Handlungsschritt
1 Rechtliche Prüfung: Herkunfts- und Aufenthaltsstaat, Form, Ehemündigkeit
2 Dokumentation: Ehefähigkeitszeugnis, Heiratsurkunde, Rechtsgutachten
3 Analyse: Gilt Ehe in Deutschland?
4 Gestaltung: Testament, Erbvertrag, Unterhaltsvereinbarung
5 Aufenthaltsprüfung: Aufenthaltstitel, Familiennachzug
6 Risikoanalyse: Bigamie, Versorgungsausgleich, Altersvorsorge
7 Alternative Absicherung: notarielle Urkunden, Verträge
8 Melde- und Anzeigepflichten: Sozialversicherung, Steuer, Meldebehörden
9 Monitoring: IPR-Änderungen, EU-Verordnungen
10 Kommunikation: Mandanten klar über Risiken informieren
Anhang B – Tabelle „Rechtliche Quellen“
Quelle Fundstelle / Relevanz
EGBGB Art. 13 Abs. 1–4 Formvoraussetzungen, frühere Ehe, ordre public
Kindereherechtsreform 2017 Automatische Unwirksamkeit bei unter 16-Jährigen
Güterrechtsverordnung (EU) 2016/1103 Recht des Güterstands bei grenzüberschreitenden Ehen
§ 172 StGB / Ordre public Bigamie, Polygamie, Nichtigerklärung bei Grundrechtsverstoß
BVerfG Spanier-Beschluss Vorrang des Grundgesetzes über ausländisches Ehehindernisrecht
IPR-Vorfragenlehre Selbstständige Anknüpfung bei Ehewirksamkeit und Erbrecht
Anhang C – Zusammenfassung der wichtigsten Praxisimplikationen
Eherechtliche Unsicherheit: Anerkennung einer Ehe ist nicht selbstverständlich.
Planungsrisiko: Auswirkungen auf Erbfolge, Unterhalt, Aufenthalt und Versorgung.
Gestaltungsspielräume: Testamente, Verträge und alternative Modelle nutzen.
Compliance: Dokumentations- und Meldepflichten erfüllen.
Monitoring: Rechtslage regelmäßig prüfen.





