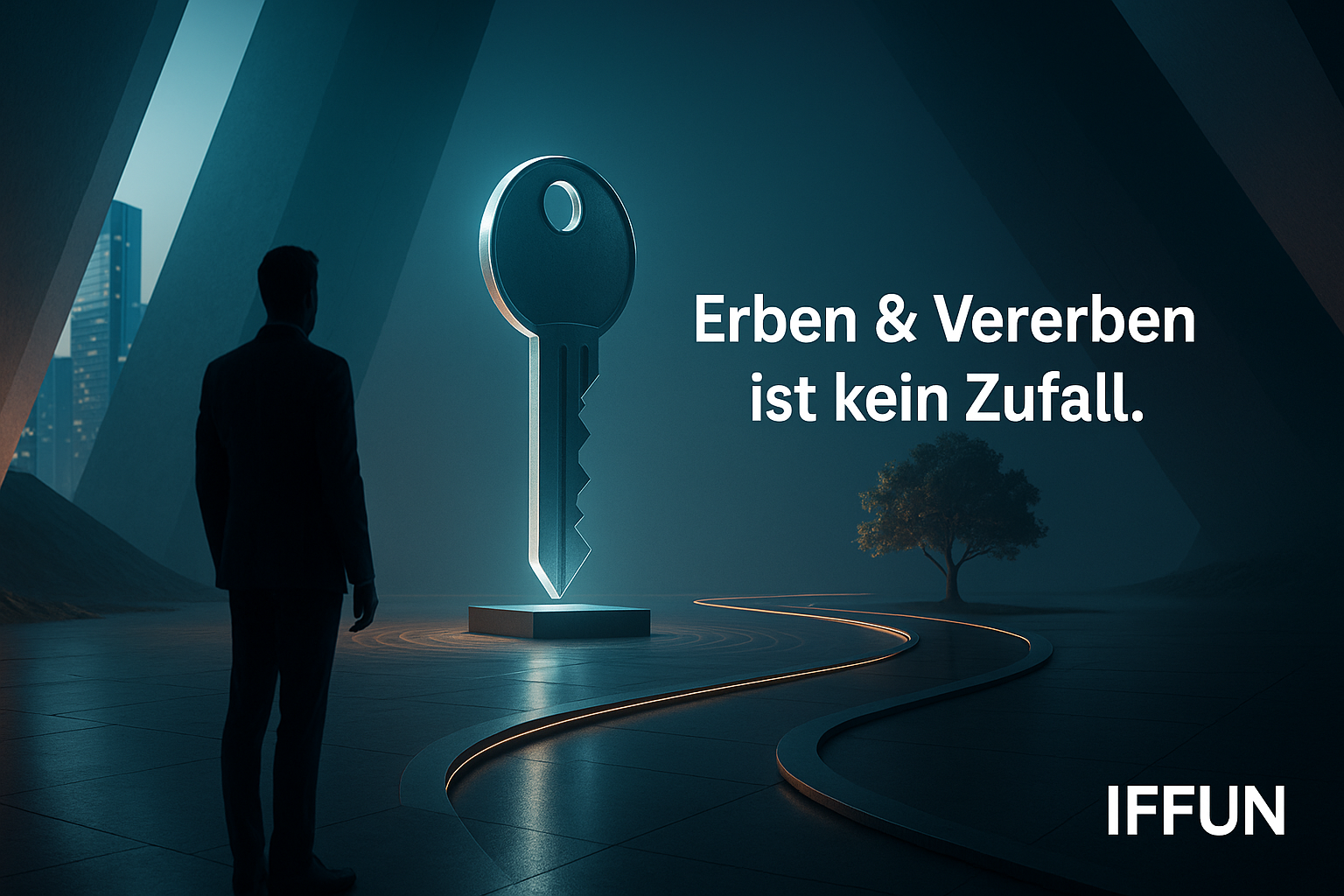Die Tücke des Verlustes – und die Verantwortung der Beratung
Ein Testament zu errichten bedeutet, selbstbestimmt über den letzten Willen zu verfügen. Doch was geschieht, wenn dieses Testament nach dem Tod nicht mehr auffindbar ist? Der Beschluss des OLG Brandenburg vom 31. März 2025 (Az. 3 W 53/24) bringt erneut Klarheit in eine rechtlich komplexe und praktisch häufig unterschätzte Situation: Die Person, die sich auf ein verschwundenes Testament beruft, trägt die volle Feststellungslast – sowohl für dessen Existenz als auch für dessen konkreten Inhalt.
Für Finanz- und Nachfolgeplaner, Erbfolgegestalter und Family Offices ergeben sich daraus klare Konsequenzen: Wer Gestaltungswillen sichern will, muss Vorsorge über den Todeszeitpunkt hinaus denken – dokumentarisch, rechtlich und kommunikativ. Der folgende Beitrag beleuchtet die juristischen Grundlagen, die typischen Beweisrisiken und bietet konkrete Handlungsstrategien aus der Praxis.
1. Juristischer Kontext: Rechtslage zur Beweislast bei verschwundenen Testamenten
Im deutschen Erbrecht gilt ein Grundsatz von hoher praktischer Relevanz: Wer sich auf ein Testament beruft, trägt die volle Darlegungs- und Beweislast für dessen Wirksamkeit (§ 2356 BGB analog). Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen das Testament:
- nie bei Gericht abgeliefert wurde (§ 2259 BGB),
- beim Verstorbenen aufbewahrt wurde und nicht mehr auffindbar ist,
- mutmaßlich vernichtet oder von Dritten unterschlagen wurde.
Der Beschluss des OLG Brandenburg vom 31.03.2025 bekräftigt, dass allein das „Nichtauffinden“ nicht automatisch zur Unwirksamkeit führt. Vielmehr können formgültige Testamente auch durch Indizien, Zeugenaussagen oder Abschriften als existent und wirksam nachgewiesen werden – allerdings unter strengen Beweisanforderungen.
Zentrale Aussagen des Gerichts:
- Die Feststellungslast für Existenz und Inhalt trägt die Person, die sich auf das Testament beruft.
- Der Verlust begründet keinen Automatismus der Unwirksamkeit.
- Zulässige Beweismittel sind etwa Kopien, Notizen, Zeugenaussagen, frühere Willensäußerungen – allerdings sind diese im Zweifel restriktiv zu würdigen.
2. Beweisrisiken in der Praxis: Wann Testamente in der Beratung zur Blackbox werden
In der vermögensnachfolgeorientierten Beratung zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Viele Testamente werden privat verwahrt – oder in Kombination mit mündlichen Absprachen getroffen. Besonders problematisch sind folgende Konstellationen:
Fallbeispiel 1: Das verschwundene Privattestament im Familiensafe
Ein Unternehmer verfasst gemeinsam mit seiner Ehefrau ein handschriftliches Berliner Testament und legt es in den Haussafe. Nach seinem Tod ist das Schriftstück verschwunden. Ein Neffe legt eine alte Fotokopie vor, die seine testamentarische Einsetzung belegen soll. Die Miterben bestreiten deren Echtheit.
Juristisches Ergebnis: Ohne weitere Belege (z. B. Notizzettel, E-Mails, Gesprächszeugen) scheitert der Nachweis – die gesetzliche Erbfolge greift.
Fallbeispiel 2: Unterschlagung durch Miterben
In Patchworkkonstellationen kommt es vor, dass ein (mitbedachter) Miterbe frühzeitig Zugang zum Nachlass hat und ein nicht zu seinen Gunsten ausgefallenes Testament „verschwindet“. Die übrigen Beteiligten vermuten einen Loyalitätsbruch – können ihn jedoch nicht gerichtsfest belegen.
Juristisches Ergebnis: Mangels beweisbarer Tatsachen bleibt das Verdachtsmoment unberücksichtigt – auch hier greift die gesetzliche Erbfolge.
Fallbeispiel 3: Kopie mit fehlender Unterschrift
Eine Mandantin übergibt dem Berater eine Kopie eines mutmaßlich formgültigen Testaments mit allen Anordnungen, allerdings ohne Unterschrift. Nach dem Tod lässt sich das Original nicht mehr finden.
Juristisches Ergebnis: Selbst wenn Inhalt und Wille plausibel sind – ohne Unterschrift keine Formwirksamkeit (§ 2247 BGB).
3. Gestaltungsmöglichkeiten zur Beweissicherung: Wie Planer frühzeitig absichern können
Die dargestellten Risiken lassen sich durch präventive Maßnahmen vermeiden – insbesondere durch transparente Dokumentation und strukturierte Verwahrung. Erfolgreiche Praxis setzt dabei auf folgende Bausteine:
1. Zentrale Verwahrung beim Nachlassgericht
Ein handschriftliches Testament kann auch ohne notarielle Beurkundung beim zuständigen Amtsgericht (Nachlassgericht) zur amtlichen Verwahrung (§ 2248 BGB) hinterlegt werden. Die Ablieferungspflicht im Todesfall (§ 2259 BGB) greift dann automatisch.
2. Notarielles Testament
Ein öffentliches Testament (§ 2232 BGB) wird automatisch beim Zentralen Testamentsregister (ZTR) registriert und amtlich verwahrt. Es bietet maximalen Beweiswert – insbesondere in komplexen Konstellationen mit Unternehmen, Immobilien oder Patchworkfamilien.
3. Dokumentation im Family Governance Prozess
Professionelle Nachfolgeplanung sollte Testamente in eine umfassende Strategie einbinden. Dazu gehören etwa:
- Protokolle aus Familiengesprächen
- begleitende Briefe (z. B. „Letter of Wishes“)
- digitale Abschriften mit Versionierung
- strukturierte Ablage in Nachlassakten oder digitalen Safe-Systemen
4. Gesprächszeugen und zeitnahe Kommunikation
Planer sollten die Testierwilligen zur regelmäßigen Kommunikation mit allen betroffenen Personen motivieren – insbesondere bei veränderten Umständen oder Korrekturen.
4. Digitalisierung und Nachlasssicherung: Perspektiven für Beraternetzwerke
Die Integration digitaler Werkzeuge in die Nachlassplanung eröffnet neue Möglichkeiten, die auch die Anforderungen des OLG-Beschlusses aufgreifen:
- Digitale Nachlassverzeichnisse: DSGVO-konform, mit Rechtemanagement
- Cloudbasierte Testamentsverwaltung: Zugänglich für definierte Berater
- Zeitstempel und Versionierung: Absicherung gegenüber Manipulation
Compliance-Pflichten für Finanzplaner:
Finanz- und Nachfolgeplaner sollten in ihren Mandatsvereinbarungen festhalten, welche Unterlagen (z. B. Testamentskopien, Vollmachten, Notizen) ihnen zur Verfügung gestellt werden und welche Rolle sie im Dokumentationsprozess übernehmen. Geklärt werden sollte insbesondere:
- Wer verwahrt?
- Wer erhält Zugriff im Notfall?
- Wie wird der Kommunikationsfluss dokumentiert?
5. Haftungsrisiken und Beratungspflichten: Wann Planer zur Rechenschaft gezogen werden können
Die Reichweite der Beratungspflichten in der Nachfolgeplanung wird zunehmend durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert. Zwar sind Berater nicht für die Existenz eines Testaments verantwortlich – wohl aber für Hinweise auf typische Risikolagen. Mögliche Vorwürfe:
- Unterlassene Empfehlung zur amtlichen Verwahrung
- Fehlende Beratung zur Testierform trotz Patchworkstruktur
- Keine Aufklärung über Beweisproblematik bei Privatverwahrung
Beratungshaftung kann sich dabei nicht nur aus expliziten Verträgen ergeben, sondern auch aus konkludenten Mandatsverhältnissen („Garantenstellung“).
6. Fazit: Ohne Nachweis kein letzter Wille – wie Berater heute vorsorgen können
Die Entscheidung des OLG Brandenburg bestätigt, was in der Praxis oft übersehen wird: Ein Testament ist nur so stark wie seine beweisbare Existenz. Für die professionelle Nachfolgeplanung bedeutet das: Gestaltung endet nicht mit dem Aufsetzen des Dokuments, sondern beginnt mit dessen Absicherung.
Beraterinnen und Berater sollten ihre Klientinnen und Klienten aktiv auf die Risiken der privaten Verwahrung hinweisen und im besten Fall eine abgestimmte Nachlassstrategie entwickeln, die auch für den Ernstfall belastbar bleibt.
Anhang A: Handlungsschritte für Berater zur Testamentssicherung
| Schritt | Maßnahme |
|---|---|
| 1 | Empfehlung zur amtlichen Verwahrung beim Nachlassgericht aussprechen |
| 2 | Alternativ: Notarielles Testament mit ZTR-Eintragung anregen |
| 3 | Erstellung digitaler Testamentskopien mit Zeitstempel |
| 4 | Hinterlegung in digitalem Nachlassarchiv oder Cloud-Lösung |
| 5 | Protokollierung von Familiengesprächen zur Testamentsstrategie |
| 6 | Identifikation von Gesprächszeugen zu Testierhandlungen |
| 7 | Hinweis auf Risiken bei alleiniger Verwahrung durch Angehörige |
| 8 | Festlegung von Zugriffsbefugnissen im Notfall |
| 9 | Dokumentation aller Beratungsleistungen und Hinweise |
| 10 | Schulung des Teams im Umgang mit Nachlassrisiken |
Anhang B: Rechtliche Quellen zur Thematik
| Norm/Quelle | Fundstelle/Bemerkung |
|---|---|
| § 2247 BGB | Formvorschriften für eigenhändige Testamente |
| § 2232 BGB | Öffentliches Testament |
| § 2248 BGB | Amtliche Verwahrung |
| § 2259 BGB | Ablieferungspflicht von Testamenten |
| § 2356 BGB | Beweislast bei testamentarischer Erbfolge |
| OLG Brandenburg | Beschluss vom 31.03.2025, Az. 3 W 53/24, BeckRS 2025, 8683 |
| ZTR | Zentrales Testamentsregister der Bundesnotarkammer |
| BGH NJW 2014, 1071 | Zur Beweiswürdigung bei verschwundenem Testament |
| Palandt § 2247 Rn. 14ff | Kommentierung zur Formerfordernis und Beweissicherung |
Anhang C: Praxisimplikationen im Überblick
- Die bloße Abwesenheit eines Testaments führt nicht automatisch zur Unwirksamkeit – wohl aber zu einer erhöhten Beweislast.
- Beratung zur Verwahrung ist keine Kür, sondern Pflicht.
- Die Beweislast trägt stets, wer vom Testament profitieren will.
- Bei privat aufbewahrten Testamenten drohen erhebliche Konflikte und Beweisprobleme.
- Digitale Lösungen können ein integraler Bestandteil zukunftsorientierter Nachfolgeplanung sein.
- Transparente Kommunikation mit Familie, Erben und Bevollmächtigten reduziert Risiken im Todesfall.
- Eine dokumentierte Nachlassstrategie schützt Mandanten – und Berater – gleichermaßen.