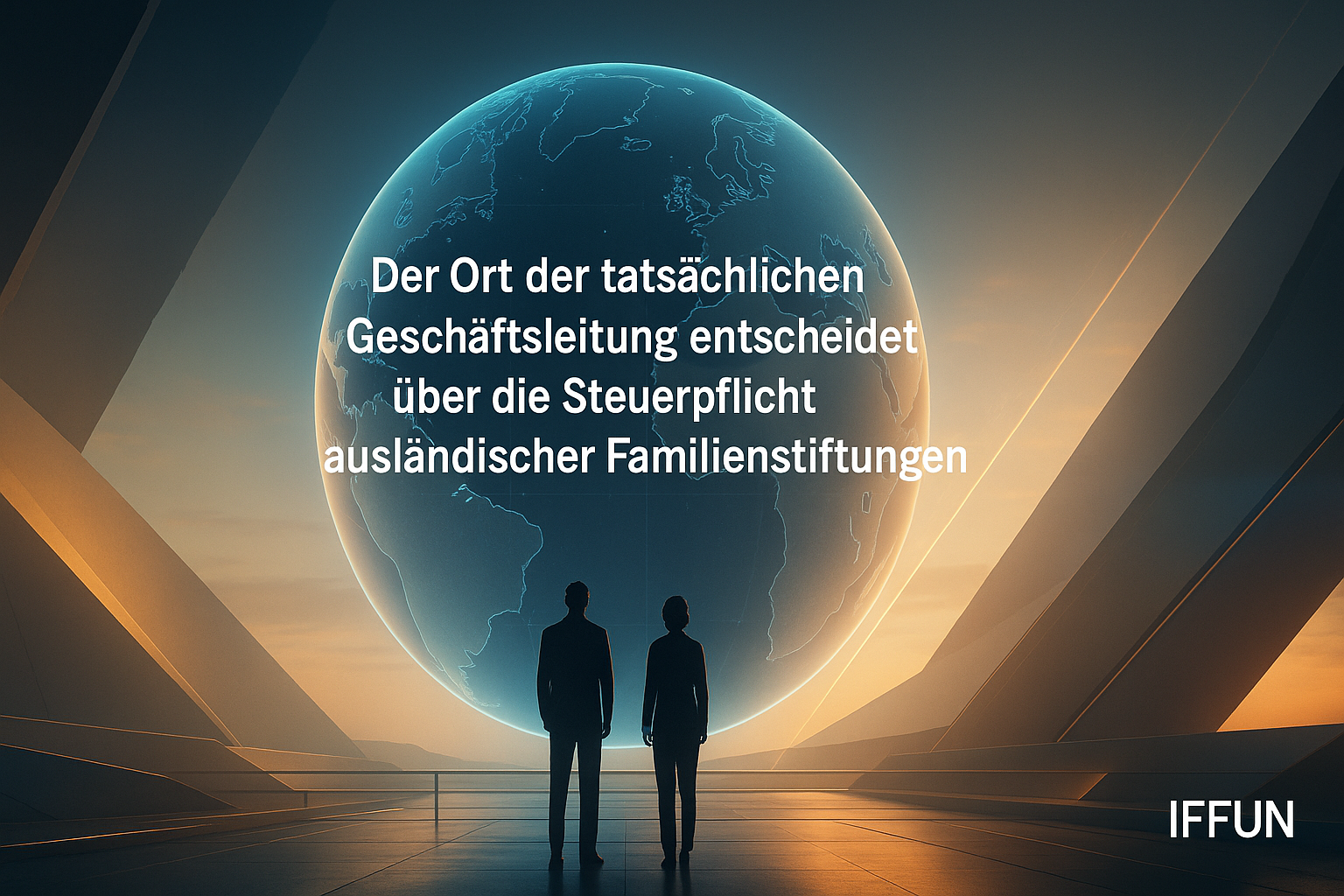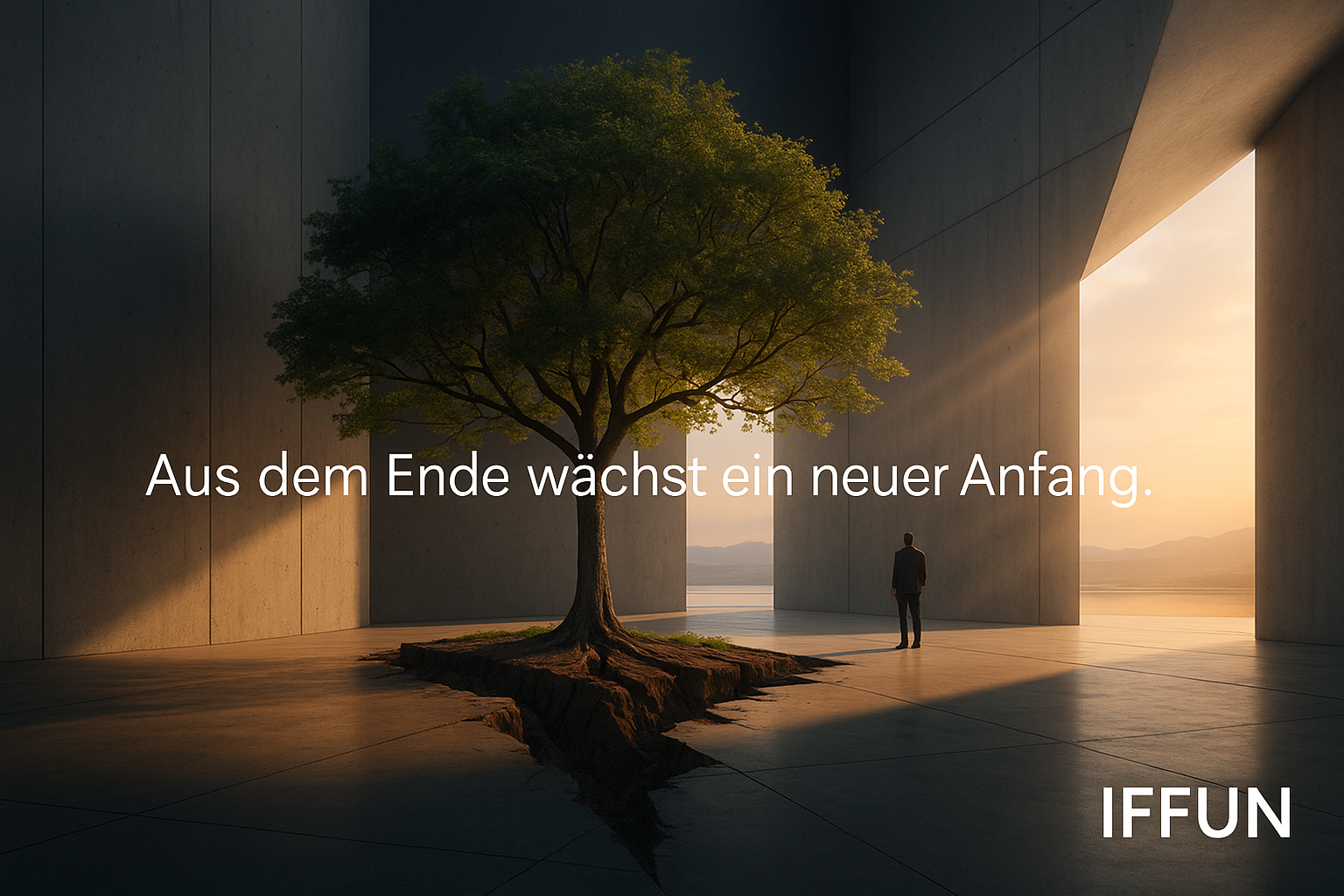Die Verschiebung des bundesweiten Stiftungsregisters eröffnet neue Handlungsspielräume – Eine fundierte Analyse für die professionelle Beratungspraxis
Die deutsche Stiftungslandschaft steht vor einer bedeutsamen Zäsur: Das ursprünglich für den 1. Januar 2026 geplante bundesweite Stiftungsregister wird auf den 1. Januar 2028 verschoben. Diese Entscheidung der Bundesregierung, die durch einen Gesetzentwurf vom 3. September 2025 manifestiert wurde, bringt sowohl operative Herausforderungen als auch strategische Chancen für Finanz- und Nachfolgeplaner mit sich.
Mit 711 Neugründungen im Jahr 2024 und einem stetigen Wachstum der Stiftungslandschaft um 2,2 Prozent gewinnt das Thema zusätzliche Brisanz. Besonders bemerkenswert: Von den 637 Neugründungen im Jahr 2023 waren 286 Familienstiftungen – ein Anteil von 45 Prozent, der die wachsende Bedeutung privater Vermögensstrukturen unterstreicht.
Download für Premium-Abonnenten
Verschiebung Stiftungsregister (3 Downloads )Die makroökonomische Dimension
Die Verschiebung tangiert nicht nur administrative Prozesse, sondern hat weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Vermögensverwaltungsbranche. Mit über 25.000 rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland und einem geschätzten Gesamtvermögen von mehreren Milliarden Euro steht ein erheblicher Marktbereich vor strukturellen Veränderungen.
Rechtliche Grundlagen und normative Veränderungen
Gesetzgebungsverfahren und Begründung
Der Gesetzentwurf zur elektronischen Akte, der die Verschiebung beinhaltet, führt als zentrale Begründung technische Verzögerungen an. Das Bundesjustizministerium konstatiert offen, dass “die notwendige Technik für das Führen des Registers noch nicht bereitsteht”. Diese Transparenz signalisiert einen Paradigmenwechsel hin zu einer realistischeren Zeitplanung bei komplexen IT-Infrastrukturprojekten.
Normenhierarchie und Rechtsquellen
Die rechtlichen Grundlagen des Stiftungsregisters basieren auf § 82b Abs. 1 BGB sowie dem ergänzenden Stiftungsregistergesetz. Die Verschiebung ändert nichts an der grundsätzlichen Eintragungspflicht aller rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Vielmehr verschiebt sich die Übergangsregelung: Bestehende Stiftungen erhalten nun eine Anmeldefrist bis zum 31. Dezember 2028 statt ursprünglich bis Ende 2026.
Auswirkungen auf Landesrecht
Die Bundesländer müssen ihre Stiftungsverzeichnisse bis 2028 weiterführen. Dies bedeutet eine Verlängerung der föderalen Struktur um weitere zwei Jahre. Für Finanzplaner ergeben sich daraus unterschiedliche Beratungsansätze je nach Bundesland, da die Länder verschiedene Verfahrensstandards und Bearbeitungszeiten aufweisen.
Gebührenstruktur und Kostenimplikationen
Offizielle Gebührenordnung
Das Bundesamt für Justiz hat die Gebührenstruktur bereits final definiert:
- Ersteintragung: 75 Euro
- Nachträgliche Änderungen: 50 Euro
- Ausnahmen: Keine Kostenbefreiungen oder ermäßigte Sätze vorgesehen
Versteckte Kosten und Begleitaufwendungen
Neben den direkten Registergebühren entstehen erhebliche Nebenkosten:
Notarielle Beglaubigungen: Alle Anmeldungen müssen öffentlich beglaubigt werden. Bei durchschnittlichen Notarkosten von 50-150 Euro je nach Dokumentenumfang ergeben sich zusätzliche Aufwendungen von mindestens 125-225 Euro pro Stiftung.
Rechtsberatung: Die Komplexität der Anmeldeverfahren erfordert in den meisten Fällen professionelle Unterstützung. Kalkulationen zeigen durchschnittliche Beratungskosten zwischen 1.500-5.000 Euro je nach Stiftungsgröße und -komplexität.
Dokumentenaktualisierung: Satzungsänderungen vor der Registrierung können zusätzliche Kosten von 2.000-10.000 Euro verursachen, abhängig vom Änderungsumfang und den Genehmigungsverfahren.
Transparenz und Publizitätswirkung: Die neue Informationsökonomie
Datenumfang und Einsichtnahme
Das Stiftungsregister wird folgende Informationen öffentlich zugänglich machen:
- Grunddaten der Stiftung (Name, Sitz, Anerkennungsdatum)
- Angaben zu Vorstandsmitgliedern und deren Vertretungsmacht
- Satzungsmäßige Beschränkungen der Vertretungsmacht
- Informationen zu besonderen Vertretern
Strategische Implikationen für Familienstiftungen
Für Familienstiftungen ergeben sich besondere Herausforderungen durch die Publizitätswirkung. Die öffentliche Einsehbarkeit von Satzungen kann sensible Familieninformationen preisgeben. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten daher proaktiv prüfen, welche Inhalte aus Satzungen in separate, nicht registerpflichtige Dokumente ausgelagert werden können.
Praxisbeispiel 1: Münchener Industriellenfamilie Eine bayerische Familienstiftung mit einem Vermögen von 15 Millionen Euro nutzte die Verschiebung zur Überarbeitung ihrer Satzung. Detaillierte Vergabekriterien für Destinatäre wurden in eine separate Geschäftsordnung ausgelagert, wodurch die öffentlich einsehbare Satzung auf grundsätzliche Regelungen reduziert wurde.
Branchenreaktionen und Stakeholder-Perspektiven
Bewertung durch Stiftungsverbände
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen äußerte sich differenziert zur Verschiebung. Generalsekretärin Friederike von Bünau betonte: “Das Stiftungsregister ist entscheidend für Vertrauen und Transparenz im Sektor. Die Verschiebung um zwei Jahre ist bedauerlich, eröffnet aber die Möglichkeit, es praxistauglicher zu machen.”
Kritische Stimmen aus der Praxis
Führende Kanzleien im Stiftungsrecht sehen die Verschiebung zwiespältig. Während die zusätzliche Vorbereitungszeit begrüßt wird, kritisieren Experten die anhaltende Rechtsunsicherheit. KPMG Law konstatiert: “Stiftungen können die Zeit bis Ende 2027 für Satzungsänderungen nutzen, da Genehmigungsverfahren sechs bis zwölf Monate dauern können.”
Strategische Handlungsempfehlungen für Beratungspraxis
Phasenmodell für die Vorbereitung
Phase 1: Bestandsaufnahme (bis März 2026)
- Vollständige Dokumentenrevision aller Mandatsstiftungen
- Identifikation vertraulicher Satzungsinhalte
- Bewertung des Überarbeitungsbedarfs
Phase 2: Satzungsoptimierung (April 2026 – Dezember 2026)
- Auslagerung sensibler Inhalte in separate Dokumente
- Anpassung an neue Transparenzanforderungen
- Vorbereitung der Antragsunterlagen
Phase 3: Genehmigungsverfahren (Januar 2027 – Juni 2027)
- Einreichung der Satzungsänderungen bei Stiftungsbehörden
- Begleitung der Genehmigungsprozesse
- Koordination mit Finanzämtern bei gemeinnützigen Stiftungen
Phase 4: Registeranmeldung (2028)
- Vorbereitung der notariellen Beglaubigungen
- Koordinierte Anmeldung zur Vermeidung von Verzögerungen
- Monitoring der ersten Registererfahrungen
Risikomanagement und Compliance
Praxisbeispiel 2: Hamburger Handel-Stiftung Eine gemeinnützige Stiftung mit Fokus auf Bildungsförderung nutzte die Verschiebung zur Implementierung eines systematischen Compliance-Systems. Durch die frühzeitige Vorbereitung konnten potenzielle Haftungsrisiken für Vorstandsmitglieder minimiert werden.
Chancen durch die Verschiebung: Strategische Neupositionierung
Optimierung der Stiftungsstrukturen
Die zweijährige Verzögerung eröffnet Gestaltungsspielräume, die bei der ursprünglichen Timeline nicht bestanden hätten:
Strukturelle Anpassungen: Stiftungen können ihre Governance-Strukturen überdenken und an moderne Anforderungen anpassen, ohne unter Zeitdruck zu stehen.
Steuerliche Optimierung: Gemeinnützige Stiftungen haben zusätzliche Zeit für die Abstimmung mit Finanzämtern bezüglich steuerlicher Auswirkungen von Satzungsänderungen.
Digitalisierung: Die Verschiebung ermöglicht eine durchdachte Digitalisierung der Stiftungsverwaltung parallel zu den regulatorischen Anpassungen.
Marktpositionierung für Berater
Finanz- und Nachfolgeplaner können die Übergangszeit nutzen, um sich als Spezialisten für Stiftungsregister-Compliance zu positionieren. Dies erfordert:
- Aufbau entsprechender Fachexpertise
- Entwicklung standardisierter Beratungsprozesse
- Investition in geeignete Software-Tools für die Registerverwaltung
Praxisbeispiel 3: Düsseldorfer Family Office Ein renommiertes Family Office entwickelte bereits 2025 ein systematisches Vorbereitungsprogramm für alle betreuten Familienstiftungen. Durch die strukturierte Herangehensweise konnten Synergieeffekte genutzt und Beratungskosten optimiert werden.
Technische Infrastruktur und Systemintegration
Registerportal und Nutzerfreundlichkeit
Das Stiftungsregister wird über das bestehende Registerportal unter www.handelsregister.de zugänglich sein. Diese Integration bietet Vorteile durch bekannte Benutzeroberflächen, kann aber auch zu Kapazitätsengpässen führen, wenn 25.000+ Stiftungen zeitgleich ihre Erstanmeldungen vornehmen.
Datenschutz und Informationssicherheit
Die öffentliche Zugänglichkeit der Registerdaten wirft komplexe datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders bei Familienstiftungen können personenbezogene Daten von Destinatären betroffen sein. Die DSGVO-Konformität erfordert durchdachte Schwärzungskonzepte und Einwilligungsverfahren.
Praxisbeispiel 4: Kölner Technologie-Stiftung
Eine Stiftung im Bereich Technologieförderung implementierte bereits 2025 ein differenziertes Datenschutzkonzept. Durch die Kategorisierung von Informationen in öffentliche, beschränkt zugängliche und vertrauliche Daten konnte eine optimale Balance zwischen Transparenz und Datenschutz erreicht werden.
Internationale Vergleichsperspektive und Best Practices
Benchmarking europäischer Stiftungsregister
Deutschland folgt mit dem Stiftungsregister internationalen Trends. Länder wie die Niederlande und das Vereinigte Königreich verfügen bereits über umfassende Register für gemeinnützige Organisationen. Die dortige Erfahrung zeigt:
- Initialregistrierungswellen führen zu temporären Systemüberlastungen
- Standardisierte Dokumentenformate reduzieren Bearbeitungszeiten erheblich
- Kontinuierliche Systemverbesserungen sind nach dem Launch notwendig
Lessons Learned aus anderen Jurisdiktionen
Niederlande (Kamer van Koophandel): Die schrittweise Einführung mit Pilotgruppen erwies sich als erfolgreich. Deutschland könnte ähnliche Ansätze für verschiedene Stiftungstypen verwenden.
Schweiz (Eidgenössische Stiftungsaufsicht): Die Kombination aus zentraler Registrierung und kantonaler Aufsicht bietet Parallelen zum deutschen System der Länderaufsicht.
Sektorspezifische Auswirkungen und Marktdynamiken
Gemeinnützige Stiftungen vs. Familienstiftungen
Die Registeranforderungen wirken sich unterschiedlich auf verschiedene Stiftungstypen aus:
Gemeinnützige Stiftungen (89% aller Stiftungen):
- Geringere Sensibilität bezüglich Transparenz
- Potenzielle Vorteile durch erhöhte Glaubwürdigkeit
- Vereinfachte Spendenakquise durch Registernachweis
Familienstiftungen (ca. 500-700 bundesweit):
- Höchste Sensibilität bezüglich Datenschutz
- Komplexere Vorbereitungsanforderungen
- Mögliche Strukturanpassungen zur Wahrung der Vertraulichkeit
Praxisbeispiel 5: Berliner Kunstförder-Stiftung Eine gemeinnützige Stiftung im Kulturbereich nutzte die Verschiebung zur Entwicklung einer digitalen Kommunikationsstrategie. Die erhöhte Transparenz durch das Register wird als Marketinginstrument für die Donor-Relations genutzt.
Auswirkungen auf Stiftungsgründungen
Analysten erwarten eine temporäre Verlangsamung von Neugründungen in 2027, da potenzielle Stifter die finale Registerausgestaltung abwarten möchten. Umgekehrt könnte 2028 eine überdurchschnittliche Gründungsaktivität verzeichnen.
Compliance-Anforderungen und Meldepflichten
Erweiterte Dokumentationspflichten
Mit dem Stiftungsregister entstehen neue Compliance-Anforderungen, die über die bisherige Stiftungsaufsicht hinausgehen:
Laufende Aktualisierungspflichten: Änderungen bei Vorstandsmitgliedern, Vertretungsbefugnissen oder Satzungsbestimmungen müssen zeitnah im Register nachgetragen werden.
Elektronische Rechnungsstellung: Ab Januar 2025 sind Stiftungen verpflichtet, elektronische Rechnungen zu empfangen und auszustellen, was systematische Prozessanpassungen erfordert.
Registrierkassen-Meldepflichten: Stiftungen mit elektronischen Kassensystemen unterliegen seit 2025 erweiterten Meldepflichten.
Haftungsrisiken für Organe
Die öffentliche Einsehbarkeit von Organinformationen erhöht potenzielle Haftungsrisiken für Vorstände und Kuratoriumsmitglieder. Finanzplaner sollten entsprechende Versicherungslösungen (D&O-Versicherung) proaktiv evaluieren.
Operative Umsetzungsstrategien
Projektmanagement-Ansatz
Die Vorbereitung auf das Stiftungsregister erfordert strukturiertes Projektmanagement:
Stakeholder-Mapping: Identifikation aller betroffenen Parteien (Stifter, Organe, Destinatäre, Aufsichtsbehörden, Berater)
Ressourcenplanung: Kalkulation der personellen und finanziellen Aufwendungen über den gesamten Vorbereitungszeitraum
Risikobewertung: Systematische Analyse potenzieller Compliance-Risiken und Entwicklung von Mitigationsstrategien
Technologische Unterstützung
Spezialisierte Software-Lösungen können die Registeranmeldung erheblich vereinfachen:
Dokumentenmanagement-Systeme: Zentrale Verwaltung aller registrierungsrelevanten Dokumente mit Versionskontrolle
Workflow-Automatisierung: Automatisierte Erinnerungen für Aktualisierungspflichten und Fristen
Schnittstellen-Integration: Anbindung an bestehende Stiftungsverwaltungssysteme zur Vermeidung von Doppelerfassung
Fazit und Ausblick
Strategische Neuausrichtung als Chance
Die Verschiebung des Stiftungsregisters auf 2028 ist mehr als eine administrative Verzögerung – sie eröffnet einen strategischen Korridor für die Neuausrichtung der deutschen Stiftungslandschaft. Finanz- und Nachfolgeplaner, die diese Zeit proaktiv nutzen, können sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.
Paradigmenwechsel im Stiftungssektor
Das Register markiert den Übergang von einer föderalen, intransparenten Stiftungslandschaft zu einem zentralisierten, transparenten System. Dieser Paradigmenwechsel erfordert eine Anpassung etablierter Beratungsansätze und die Entwicklung neuer Servicemodelle.
Handlungsimperativ für Berater
Die verbleibenden Jahre bis 2028 sollten intensiv für die Entwicklung entsprechender Fachexpertise genutzt werden. Berater, die frühzeitig in Stiftungsregister-Kompetenz investieren, werden von der absehbaren Nachfragewelle profitieren.
Die Verschiebung bietet die seltene Gelegenheit, einen regulatorischen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu gestalten. Für die professionelle Finanz- und Nachfolgeplanung eröffnen sich damit erhebliche Marktpotenziale in einem wachsenden und zunehmend professionalisierten Segment.
Anhang A: Handlungsschritte für Finanz- und Nachfolgeplaner
| Priorität | Maßnahme | Zeitraum | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
| Hoch | Bestandsaufnahme aller Mandatsstiftungen durchführen | Bis März 2026 | Beratungsteam |
| Hoch | Identifikation kritischer Satzungsinhalte | Bis Juni 2026 | Rechtsabteilung |
| Hoch | Entwicklung standardisierter Beratungsprozesse | Bis September 2026 | Geschäftsführung |
| Mittel | Schulung der Beraterteams zu Registeranforderungen | Bis Dezember 2026 | HR/Weiterbildung |
| Mittel | Implementierung von Projektmanagement-Tools | Bis März 2027 | IT-Abteilung |
| Mittel | Aufbau strategischer Partnerschaften mit Notaren | Bis Juni 2027 | Geschäftsentwicklung |
| Niedrig | Entwicklung von Marketing-Materialien | Bis September 2027 | Marketing |
| Niedrig | Vorbereitung von Kundenschulungen | Bis Dezember 2027 | Beratung |
Anhang B: Rechtliche Quellen und Fundstellen
| Rechtsgrundlage | Fundstelle | Status | Relevanz |
|---|---|---|---|
| § 82b Abs. 1 BGB | BGBl. I 2021, S. 2947 | In Kraft | Grundlegende Registerpflicht |
| Stiftungsregistergesetz | Noch nicht verkündet | Geplant 2028 | Verfahrensregelungen |
| Gesetzentwurf E-Akten-Gesetz | BR-Drs. 347/25 | Im Verfahren | Verschiebung auf 2028 |
| Stiftungsregisterverordnung | In Vorbereitung | Geplant Ende 2026 | Technische Details |
| BNotO § 39 | BGBl. I 1961, S. 297 | In Kraft | Beglaubigungspflichten |
Offizielle Informationsquellen:
- Bundesamt für Justiz: www.bundesjustizamt.de
- Bundesjustizministerium: www.bmj.de
- Bundesverband Deutscher Stiftungen: www.stiftungen.org
Anhang C: Praxisimplikationen im Überblick
Kurzfristige Auswirkungen (2026-2027)
- Rechtssicherheit: Fortsetzung der bestehenden Länderverfahren
- Planungssicherheit: Ausreichend Zeit für Satzungsanpassungen
- Kostenstabilität: Keine zusätzlichen Registergebühren
Mittelfristige Auswirkungen (2028-2030)
- Transparenzschub: Öffentliche Einsehbarkeit aller Registerdaten
- Professionalisierung: Erhöhte Anforderungen an Stiftungsverwaltung
- Marktkonsolidierung: Mögliche Zusammenschlüsse kleinerer Stiftungen
Langfristige Auswirkungen (ab 2031)
- Digitale Integration: Vollständig digitalisierte Stiftungsverwaltung
- Internationale Kompatibilität: Anschluss an EU-weite Transparenzinitiativen
- Professioneller Standard: Stiftungsregister als Qualitätsmerkmal etabliert
Erfolgs-KPIs für Beratungspraxis:
- Anzahl erfolgreich registrierter Mandatsstiftungen
- Durchschnittliche Vorbereitungszeit pro Stiftung
- Kundenzufriedenheit bei Registrierungsprozessen
- Marktanteil bei Stiftungsregister-Beratung
Dieser Beitrag basiert auf dem aktuellen Rechtsstand September 2025 und berücksichtigt die neuesten Entwicklungen zum Stiftungsregister. Für spezifische Beratungsanfragen wenden Sie sich an qualifizierte Finanz- und Nachfolgeplaner.