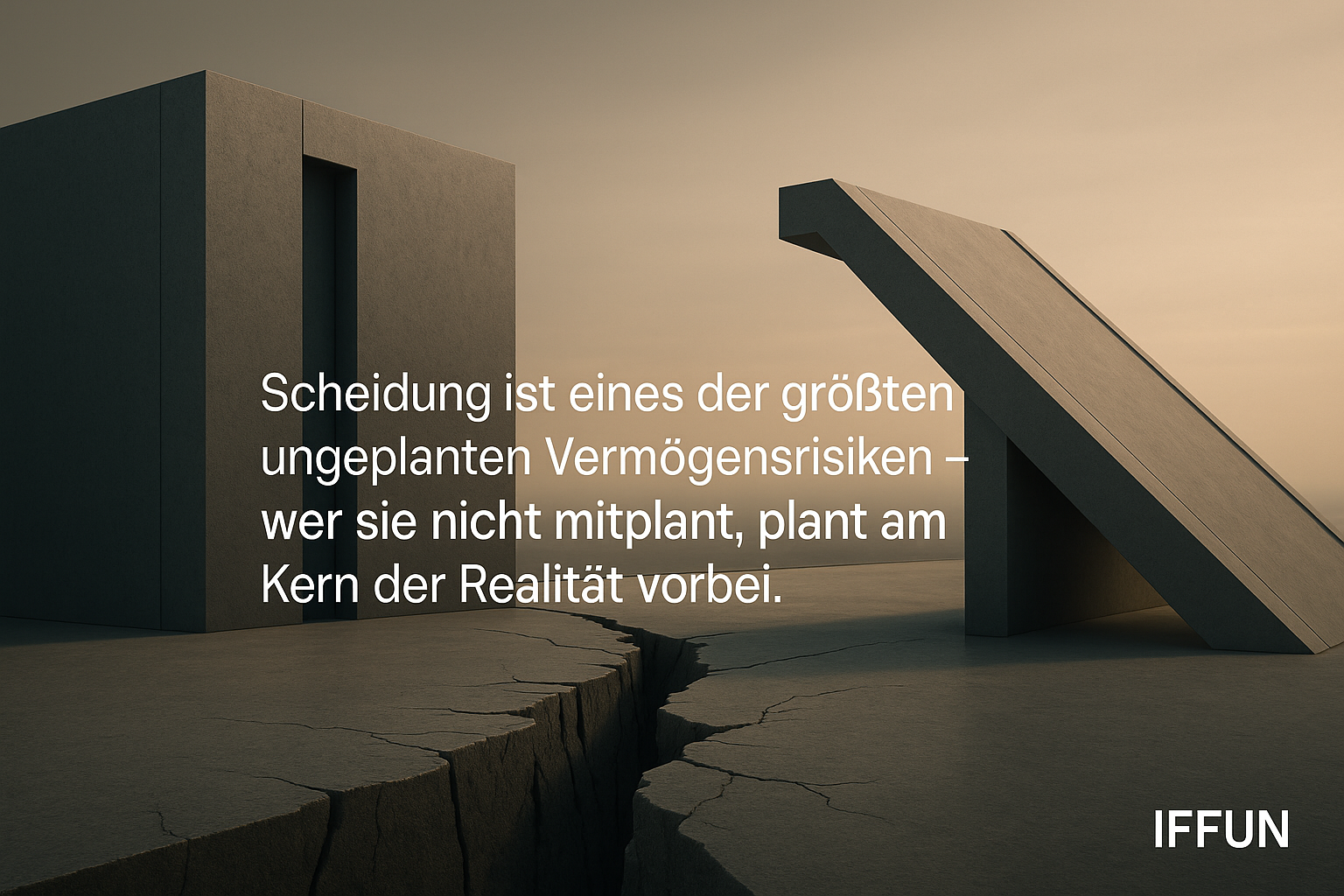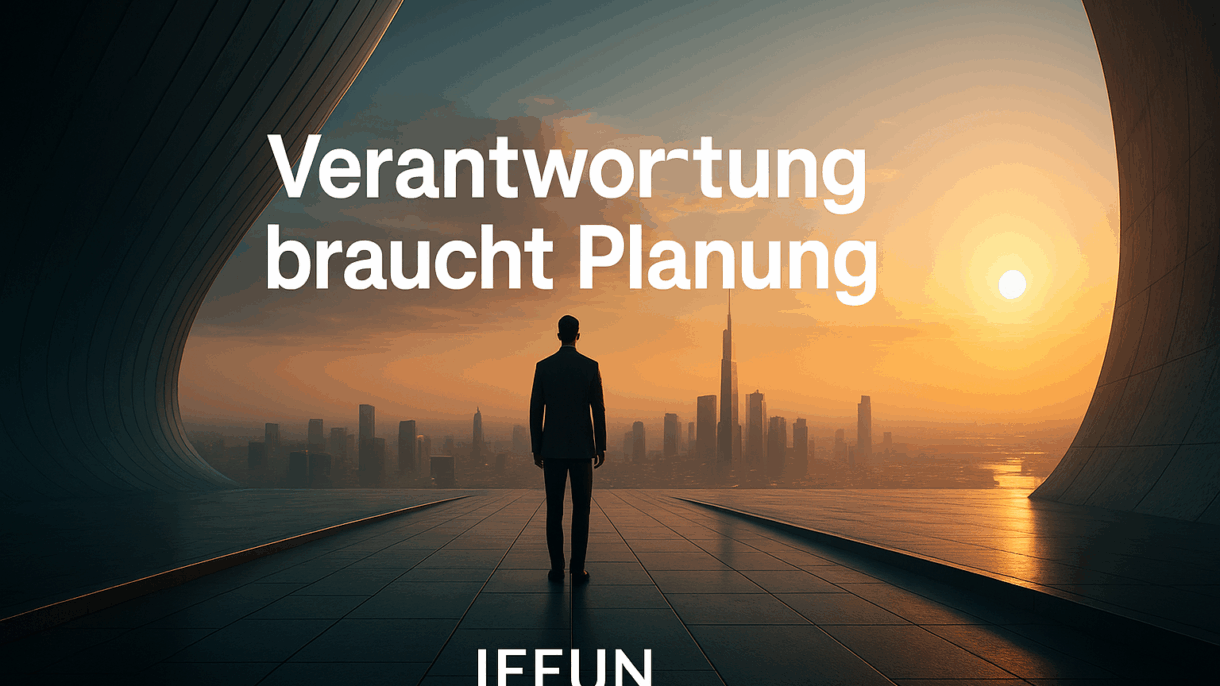
Was bei Trennung und Scheidung zu beachten ist
Trennung bedeutet nicht nur emotionale Umwälzung – sondern auch finanzielle und rechtliche Neujustierung. In kaum einem anderen Lebensbereich wird das Spannungsfeld zwischen persönlicher Verantwortung und gesetzlicher Pflicht so greifbar wie beim Thema Unterhalt. Dabei stehen Betroffene und ihre Berater gleichermaßen vor der Frage: Was ist gerecht? Was ist machbar? Und was ist rechtlich geboten?
Der Unterhalt ist mehr als eine finanzielle Leistung – er ist Spiegel gesellschaftlicher Leitbilder, wirtschaftlicher Realitäten und juristischer Abwägungen. Für Finanz- und Nachfolgeplaner ist das Thema besonders sensibel: Es berührt Liquiditätsfragen, Vermögensstrukturen und steuerliche Implikationen – mitunter über Jahre hinweg.
1. Begriffliche und systematische Grundlagen
1.1 Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB)
Während der Trennungszeit besteht zwischen den Ehegatten weiterhin eine Unterhaltspflicht, sofern ein Partner bedürftig und der andere leistungsfähig ist. Ziel ist die Wahrung des bisherigen Lebensstandards – zumindest für eine Übergangszeit. Eine Erwerbsverpflichtung trifft den unterhaltsberechtigten Ehegatten in der Regel nicht sofort nach der Trennung.
Praxisbeispiel: Frau M., 46, war während der Ehe nicht erwerbstätig und kümmerte sich um die schulpflichtigen Kinder. Nach der Trennung lebt sie weiterhin im gemeinsamen Haus, während Herr M., leitender Angestellter mit 9.500 Euro Nettoeinkommen, ausgezogen ist. Das Familiengericht spricht ihr einen monatlichen Trennungsunterhalt in Höhe von 2.100 Euro zu – vorläufig befristet auf ein Jahr.
1.2 Nachehelicher Unterhalt (§§ 1570 ff. BGB)
Nach Rechtskraft der Scheidung endet die automatische Unterhaltspflicht – stattdessen gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Nur wer aufgrund besonderer Umstände (Kinderbetreuung, Krankheit, Alter, Erwerbslosigkeit) außerstande ist, selbst für sich zu sorgen, hat Anspruch auf nachehelichen Unterhalt. Die Anspruchsdauer ist regelmäßig zu begrenzen oder zu befristen.
Praxisbeispiel: Nach der Scheidung von Frau L., die über 15 Jahre Hausfrau war und keine abgeschlossene Ausbildung besitzt, lebt das jüngste Kind (12 Jahre) weiter bei ihr. Aufgrund der Betreuungspflicht erkennt das Gericht einen nachehelichen Unterhaltsanspruch bis zur Volljährigkeit des Kindes an – in Höhe von 1.500 Euro monatlich. Gleichzeitig wird die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung nach zwei Jahren erwartet.
1.3 Kindesunterhalt (§§ 1601 ff. BGB)
Eltern sind ihren Kindern gegenüber verpflichtet, für Unterhalt zu sorgen – unabhängig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht. Lebt das Kind bei einem Elternteil, erfüllt dieser seine Pflicht durch Betreuung („Naturalunterhalt“), der andere durch monatliche Barunterhaltszahlungen. Die Höhe richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle und dem Einkommen des Verpflichteten.
Praxisbeispiel: Herr S., 38, verdient als Softwareentwickler netto 4.000 Euro. Seine 8-jährige Tochter lebt nach der Trennung bei der Mutter. Laut Düsseldorfer Tabelle (Stand 2025) schuldet Herr S. für die Altersgruppe 6–11 Jahre rund 612 Euro Kindesunterhalt. Nach Abzug des hälftigen Kindergeldes ergibt sich ein zu zahlender Betrag von ca. 528 Euro pro Monat.
2. Die wirtschaftliche Realität im Blick
2.1 Unterhalt als Dauerbelastung – auch für Unternehmerfamilien
Insbesondere bei hohem Einkommen oder Unternehmensbeteiligungen geraten klassische Berechnungsmodelle an Grenzen. Welches Einkommen ist relevant? Welche unternehmerischen Risiken sind zu berücksichtigen? Und wie wird nicht entnommener Gewinn aus Kapitalgesellschaften behandelt?
2.2 Steuerliche Betrachtung
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden – entweder als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastung. Die steuerliche Abzugsfähigkeit hängt dabei maßgeblich von der Zustimmung des Empfängers sowie der Art des Unterhalts ab.
Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten sind bis zu 13.805 Euro jährlich als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Unterhaltsempfänger schriftlich zustimmt – denn im Gegenzug muss er diese Leistungen als sonstige Einkünfte versteuern (§ 22 Nr. 1a EStG).
Praxisbeispiel: Herr W. zahlt seiner geschiedenen Ehefrau monatlich 1.000 Euro nachehelichen Unterhalt. → Jährlicher Gesamtbetrag: 12.000 Euro → Da seine Ex-Frau der steuerlichen Veranlagung zugestimmt hat, kann Herr W. den Betrag als Sonderausgaben geltend machen. → Seine Steuerlast sinkt – abhängig vom persönlichen Steuersatz – um bis zu ca. 4.000–5.000 Euro pro Jahr. → Die Ex-Frau muss die 12.000 Euro versteuern.
Außergewöhnliche Belastungen (§ 33a EStG) Wenn keine Zustimmung zur Besteuerung vorliegt, kann der Unterhalt als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden – gedeckelt auf 10.908 Euro (2025) und nur bei Bedürftigkeit des Empfängers.
Praxisbeispiel: Frau K. zahlt an ihren dauerhaft getrennt lebenden Ehemann 900 Euro monatlich. Dieser lebt ohne Einkommen in einer Mietwohnung. Eine Zustimmung zur Besteuerung verweigert er. → Jährliche Belastung: 10.800 Euro → Der Betrag wird als außergewöhnliche Belastung anerkannt – aber nur begrenzt steuerwirksam.
Kindesunterhalt ist nicht steuerlich absetzbar Kindesunterhalt wird durch Freibeträge (Kinderfreibetrag, Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf) sowie durch das Kindergeld berücksichtigt – eine steuerliche Doppelbegünstigung ist ausgeschlossen.
Praxisbeispiel: Herr M. zahlt 650 Euro monatlich für seine Tochter (16 Jahre). Obwohl dies über 7.800 Euro im Jahr bedeutet, kann er diesen Betrag nicht absetzen. Die steuerliche Entlastung erfolgt über den Kinderfreibetrag bzw. das Kindergeld.
2.3 Liquidität vs. Substanz
Regelmäßige Unterhaltszahlungen können langfristig die Vermögensstruktur gefährden – etwa, wenn Immobilien veräußert oder Beteiligungen aufgelöst werden müssen. Ohne frühzeitige Planung droht finanzielle Erosion. Ein professioneller Planungsansatz muss daher stets auch Substanzschutz und Liquiditätssicherung kombinieren.
3. Beratungsansätze für Finanz- und Nachfolgeplaner
3.1 Perspektivwechsel fördern
Statt Unterhalt rein als „Zahlungsverpflichtung“ zu sehen, lohnt sich ein Perspektivwechsel: Was braucht der Ex-Partner realistisch? Wie lässt sich eine faire und tragfähige Lösung gestalten – finanziell wie emotional?
3.2 Versorgungsausgleich und Unterhalt zusammendenken
Der Versorgungsausgleich (z. B. Rentenansprüche, § 1587 BGB) beeinflusst das Gesamtbild: Oft ist es sinnvoll, durch einvernehmliche Regelungen klare Verhältnisse zu schaffen – z. B. Kapitalausgleich statt Rententeilung.
3.3 Vermögenswerte nutzen statt verschenken
Durch kluge Vermögensstrukturierung (z. B. Nießbrauch, Wohnrechte, Sachleistungen) kann ein individueller Ausgleich geschaffen werden, der liquiditätsschonend ist – und dennoch Verbindlichkeit signalisiert.
4. Rechtliche Fallstricke & Gestaltungsoptionen
| Bereich | Problem | Lösung/Empfehlung |
|---|---|---|
| Trennungsunterhalt | Wann endet der Anspruch? | Klare Vereinbarungen im Ehevertrag oder gerichtliche Entscheidung einholen |
| Nachehelicher Unterhalt | Eigenverantwortung nicht eindeutig | Begrenzung oder Befristung prüfen (§ 1573 Abs. 5 BGB) |
| Kindesunterhalt | Selbstständige mit schwankendem Einkommen | Durchschnittseinkommen aus mehreren Jahren zugrunde legen |
| Unternehmensbeteiligung | Cashflow-basiert oder Substanzbesteuerung? | Fachanwalt und Steuerberater frühzeitig einbinden |
| Unterhaltsvereinbarungen | Formfehler oder Sittenwidrigkeit | Schriftform, Notar oder gerichtliche Genehmigung beachten |
5. Praxisbeispiel: Wenn die GmbH plötzlich „zahlen muss“
Ein Unternehmer (52) trennt sich nach 20 Jahren Ehe. Die Ehefrau (Hausfrau) fordert Trennungsunterhalt, später nachehelichen Unterhalt. Problem: Das Einkommen des Unternehmers besteht fast ausschließlich aus Gewinnausschüttungen, die noch nicht erfolgt sind. Die GmbH ist bilanziell gesund, aber liquiditätsarm.
Ein Fachberater gestaltet gemeinsam mit Anwalt und Steuerberater eine Lösung:
- Staffelung der Zahlungen nach Ausschüttungszeitpunkt
- Teilweise Übernahme durch eine Vermögensübertragung (z. B. Nießbrauch am Mietobjekt)
- Abschluss einer befristeten Unterhaltsvereinbarung mit Abfindungskomponente
Fazit
Unterhalt ist mehr als eine Pflicht – er ist auch ein Spiegelbild dessen, wie Trennung „gelingen“ kann. Wer hier frühzeitig plant, schafft Sicherheit für beide Seiten und bewahrt die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.
Professionelle Finanz- und Nachfolgeplanung ist kein juristischer Ersatz – aber ein elementarer Begleiter. Sie hilft, Konflikte zu vermeiden, faire Lösungen zu entwickeln und den Blick auf das Wesentliche zu richten: Verantwortung.
Tabellenanhang: Handlungsschritte – rechtliche Quellen – Praxisimplikationen
Handlungsschritte für Berater:
- Unterhaltsarten differenziert erfassen
- Einkommen realistisch und nachhaltig berechnen (inkl. Unternehmensanteile)
- Steuerliche Behandlung prüfen (insb. Sonderausgabenabzug)
- Vermögensstruktur prüfen – Liquidität sichern
- Schriftliche Vereinbarungen mit juristischer Unterstützung erstellen
Wichtige rechtliche Quellen:
- §§ 1361, 1570 ff. BGB – Ehegattenunterhalt
- §§ 1601 ff. BGB – Kindesunterhalt
- § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG – Sonderausgabenabzug
- Düsseldorfer Tabelle – Kindesunterhalt
- § 1587 BGB – Versorgungsausgleich
Praxisimplikationen:
- Frühzeitige Nachfolgestrukturierung sichert Vermögen trotz Unterhaltspflichten
- Beratung schafft Klarheit über Rechte, Pflichten und Optionen
- Kombination aus juristischem Know-how und finanzplanerischer Sicht ist zentral