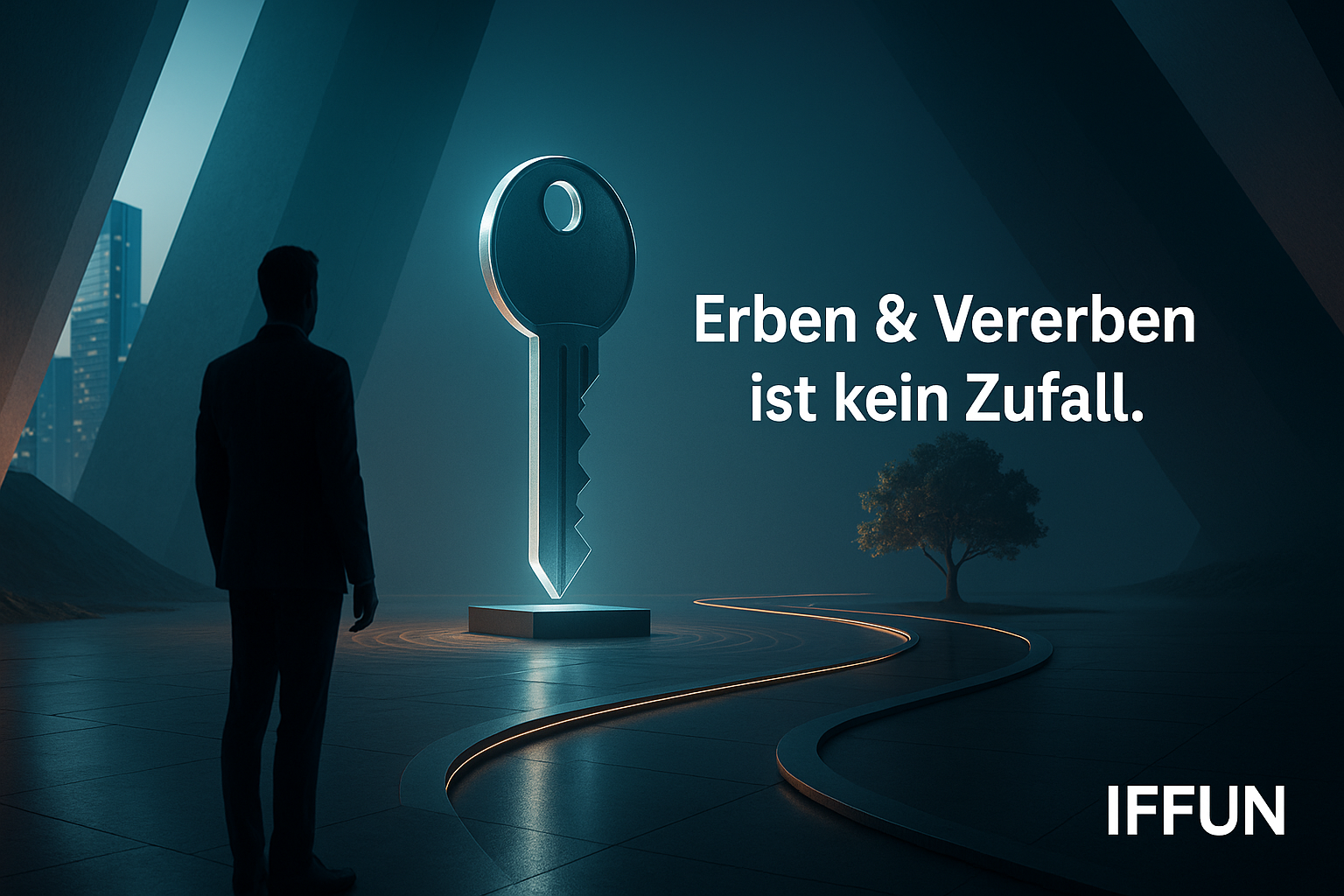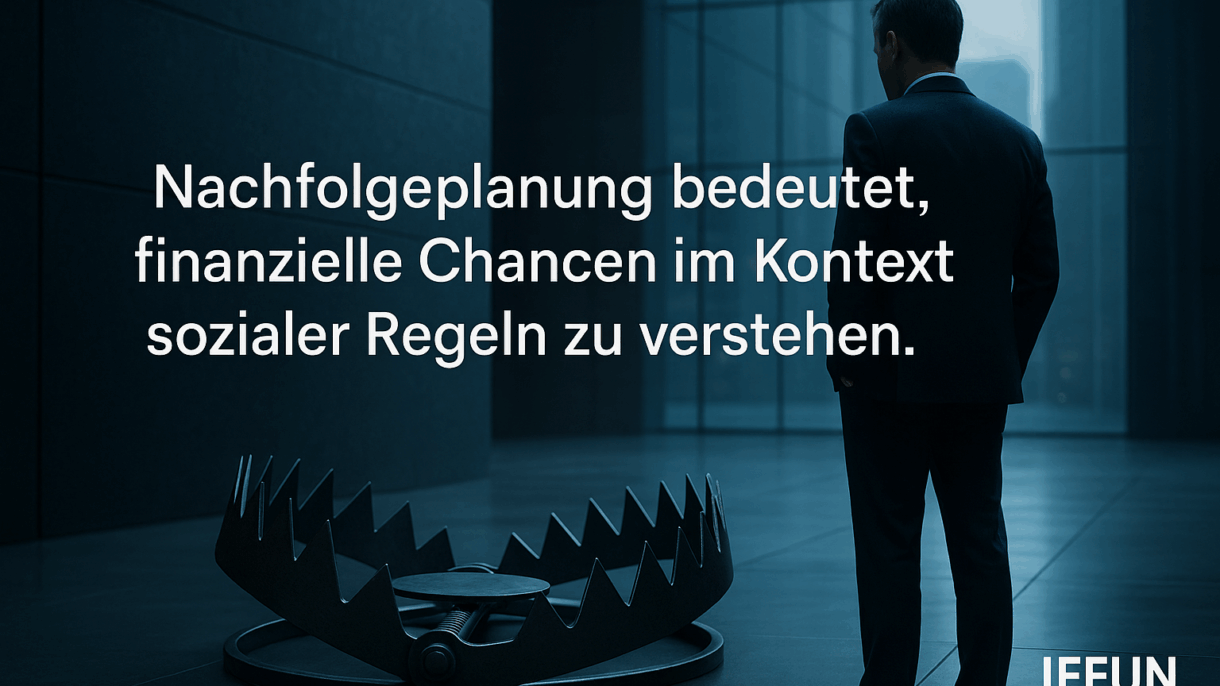
Erben gilt in Deutschland lange als Chance auf Stabilität, Aufstieg und die Fortsetzung einer Familiengeschichte. Doch nicht jeder profitiert uneingeschränkt. Wer Bürgergeld bezieht, muss nach aktueller Rechtsprechung eine Erbschaft als Vermögen anrechnen lassen – mit der Folge, dass staatliche Unterstützung wegfällt, bis dieses Vermögen weitgehend verbraucht ist.
Für viele Familien ist das ein unerwarteter Bruch. Denn das, was als Unterstützung gemeint war, wird rechtlich zur Selbstfinanzierung. Diese Entwicklung zwingt Berater in der Finanz- und Nachfolgeplanung, die Schnittstelle zwischen Erbrecht, Steuerrecht und Sozialrecht neu zu denken.
Die neue Rechtslage
Das Bürgergeld knüpft an Bedürftigkeit. Wer eigenes Vermögen besitzt, soll es einsetzen, bevor der Staat hilft. Eine Erbschaft verändert damit die Anspruchslage unmittelbar. Anders als laufendes Einkommen wird sie nicht als monatlicher Zufluss, sondern als Vermögensbestand behandelt – und muss zur Deckung des Lebensunterhalts verwendet werden.
Schon kleine Beträge können gravierende Folgen haben. Erbt jemand 5.000 Euro, kann dies zum Aussetzen der Leistung führen, bis die Summe verbraucht ist. Erst danach lebt der Anspruch wieder auf.
Gesellschaftliche Dimension
Diese Regelung wirft Fragen auf, die weit über juristische Feinheiten hinausgehen. Sie betrifft Grundsatzthemen:
Gerechtigkeit: Ist es gerecht, dass ein Erbe Leistungen mindert, auch wenn es der Verstorbene anders gemeint hatte?
Solidarität: Soll die Gesellschaft weiterhin unterstützen, wenn jemand Vermögen besitzt – oder soll dieses Vermögen zunächst genutzt werden?
Eigenverantwortung: Trägt der Einzelne die Pflicht, Erbschaften für seinen Lebensunterhalt einzusetzen, bevor er Hilfe beansprucht?
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zeigt sich: Deutschland verfolgt einen klaren Vorrang der Eigenmittel. In Frankreich etwa gibt es differenziertere Modelle, in denen bestimmte Erbschaften teilweise geschützt bleiben.
Juristische Einordnung
Das Sozialrecht unterscheidet zwischen Einkommen und Vermögen. Einkommen ist das, was regelmäßig zufließt – Vermögen das, was bereits vorhanden ist. Eine Erbschaft fällt unter Vermögen. Entscheidend ist, dass Freibeträge berücksichtigt werden:
Schonvermögen bleibt unangetastet (z. B. kleinere Barbeträge, notwendige Haushaltsgegenstände, Altersvorsorge).
Alles darüber hinaus gilt als einzusetzendes Vermögen.
Ein Beispiel: Ein Bürgergeldempfänger erbt ein Auto im Wert von 15.000 Euro. Wenn das Auto nicht zur beruflichen Integration benötigt wird, kann es als verwertbares Vermögen eingestuft werden. Das Amt verlangt dann, dass es verkauft wird, bevor Leistungen weiterfließen.
Auswirkungen auf Familien
Für die Praxis bedeutet dies: Testamente, die schlicht Kinder oder Partner bedenken, können unerwünschte Nebenwirkungen haben. Wer Bürgergeld bezieht, sieht sich plötzlich ohne Leistungen, während andere Erben ihre Zuwendung frei nutzen können.
Die Belastung ist nicht nur finanziell, sondern auch emotional: Viele fühlen sich durch die Anrechnung ungerecht behandelt. Der eigentlich fürsorgliche Wille des Erblassers wird zum Grund für staatlichen Rückzug.
Ein Mandant formulierte es so:
🗣️ „Ich dachte, die 30.000 Euro meiner Mutter würden mir helfen. Stattdessen wurde mir das Bürgergeld gestrichen. Ich fühlte mich doppelt bestraft – zuerst durch den Verlust, dann durch die Folgen des Erbes.“
Praxisnahe Fallbeispiele
Kleine Erbschaften
Eine Erbin erhält 5.000 Euro aus einem Sparbuch. Das Amt setzt die Leistungen aus. Innerhalb von sechs Monaten ist das Geld aufgebraucht. Erst dann lebt der Anspruch wieder auf.
Immobilienerbschaften
Ein Sohn erbt das Einfamilienhaus seines Vaters. Er lebt selbst von Bürgergeld. Das Haus ist vermietbar, aber nicht sofort liquidierbar. Die Behörde bewertet es als Vermögen, sodass der Anspruch entfällt. Der Zwang zum Verkauf wird zur Belastung.
Patchwork-Situationen
In einer Familie erben drei Kinder je 20.000 Euro. Zwei sind berufstätig, eines bezieht Bürgergeld. Während die Geschwister ihr Erbe nutzen, muss das dritte Kind zunächst das Bürgergeld aufgeben. Diese Ungleichheit führt zu Spannungen in der Familie.
Beratungsbedarf in der Nachfolgeplanung
Für Finanz- und Nachfolgeplaner ergeben sich klare Aufgaben:
Frühzeitige Analyse: Welche Angehörigen könnten beim Erben Leistungen verlieren?
Aufklärung: Mandanten müssen verstehen, dass Sozialrecht Erbschaften anders bewertet als Steuerrecht.
Gestaltung: Testamente müssen angepasst werden, um Benachteiligungen zu vermeiden.
Gestaltungsoptionen für Nachfolgeplaner
Testamentarische Lösungen
Anstelle einer direkten Erbeinsetzung können Vermächtnisse eingesetzt werden. So bleibt Gestaltungsspielraum, etwa durch zweckgebundene Zuwendungen.
Vor- und Nacherbschaft
Durch Vor- und Nacherbschaft lässt sich die Verfügung zeitlich staffeln. Bürgergeldempfänger könnten erst später zum Zuge kommen, wenn sie nicht mehr in der Bedürftigkeit sind.
Nießbrauchsmodelle
Immobilien können mit Nießbrauch belastet werden. Der Erbe erhält zunächst nur Nutzungen, nicht aber die volle Verwertbarkeit. Dies kann den Zugriff verzögern.
Testamentsvollstreckung
Ein Testamentsvollstrecker kann verhindern, dass Erben sofortigen Zugriff auf das Vermögen haben. Dadurch wird die Anrechenbarkeit reduziert.
Stiftungsmodelle
In komplexeren Fällen kann die Übertragung an eine Stiftung helfen, Versorgung und Zweckbindung zu verbinden.
Steuerliche Dimension
Die Schnittstelle von Erbschaftsteuerrecht und Sozialrecht ist ein weiterer Stolperstein.
Ein Erbe kann steuerfrei bleiben, wenn es unterhalb der Freibeträge liegt.
Dennoch wird es als Vermögen angerechnet und führt zum Wegfall des Bürgergeldes.
Ein Beispiel:
Ein Alleinerbe erhält 300.000 Euro von seiner Mutter. Steuerlich bleibt dies aufgrund des Freibetrags von 400.000 Euro steuerfrei. Sozialrechtlich verliert er jedoch sofort seinen Anspruch auf Bürgergeld.
Rechenbeispiele
Beispiel 1: Kleine Erbschaft
Erbe: 5.000 Euro
Monatlicher Bedarf: 1.000 Euro
Folge: Bürgergeld entfällt für 5 Monate. Danach lebt der Anspruch wieder auf.
Beispiel 2: Mittlere Erbschaft
Erbe: 30.000 Euro
Monatlicher Bedarf: 1.000 Euro
Folge: Bürgergeld entfällt für 30 Monate. Nach Verbrauch der Summe erneuter Anspruch.
Beispiel 3: Immobilie
Erbe: Haus im Wert von 200.000 Euro
Monatlicher Bedarf: 1.000 Euro
Folge: Bürgergeld entfällt dauerhaft, da Immobilie verwertbar ist. Verkauf oder Beleihung wird verlangt.
Haltung und Klarheit in der Beratung
Die Aufgabe des Beraters liegt nicht in Schönfärberei, sondern in Klarheit. Mandanten müssen wissen, dass eine Erbschaft nicht automatisch Sicherheit bedeutet, wenn staatliche Leistungen im Spiel sind.
Die Verantwortung besteht darin, Wege aufzuzeigen, wie Familienziele und rechtliche Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden können. Das kann auch heißen, bestimmte Erben bewusst anders zu bedenken oder Stiftungs- bzw. Verwaltungslösungen einzubauen.
Fazit
Die Anrechnung von Erbschaften als Vermögen beim Bürgergeld verändert die Spielregeln. Für Betroffene ist sie oft schmerzhaft, für Berater ein klarer Auftrag. Denn Nachfolgeplanung endet nicht beim Erben – sie beginnt beim Verstehen der Folgen.
🔑 Leitsatz: Nachfolgeplanung bedeutet, finanzielle Chancen im Kontext sozialer Regeln zu verstehen.
Anhang A: Handlungsschritte für Berater
Mandanten aktiv auf Sozialrechts-Aspekte ansprechen.
Klären, ob potenzielle Erben Leistungen beziehen.
Gestaltungsoptionen im Testament aufzeigen.
Steuerliche und sozialrechtliche Folgen parallel beleuchten.
Bei komplexen Fällen interdisziplinär mit Juristen und Steuerberatern arbeiten.
Anhang B: Übersicht rechtlicher Grundlagen
Abgrenzung Einkommen/Vermögen im Sozialrecht
Schonvermögen und Freibeträge
Behandlung von Immobilien, Geldvermögen, Lebensversicherungen
Möglichkeiten der Verwertung
Anhang C: Praxisimplikationen
Nachlassplanung erfordert interdisziplinäres Denken.
Emotional belastende Folgen können vermieden werden.
Beratungsqualität zeigt sich an der Verbindung von Steuerrecht, Zivilrecht und Sozialrecht.