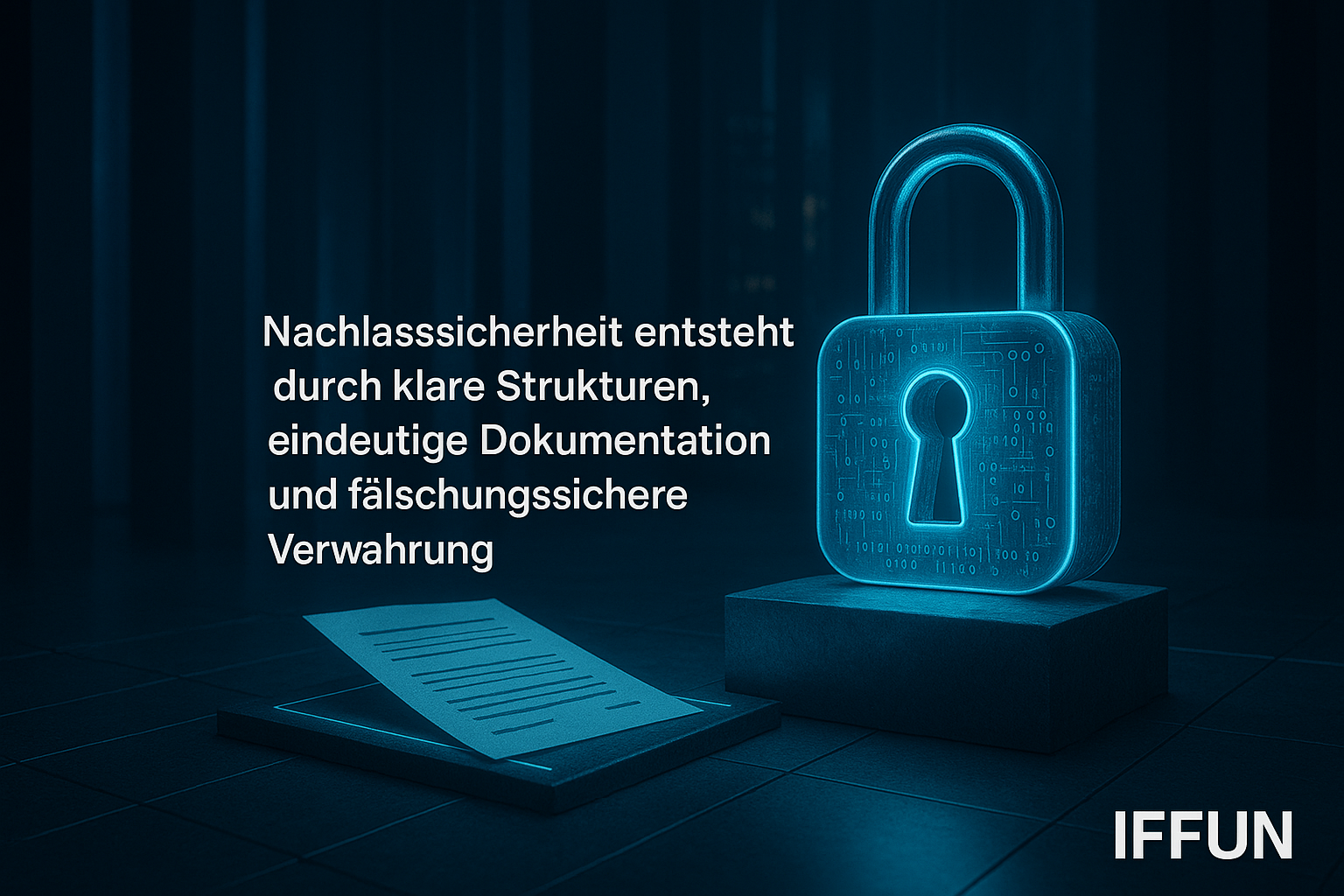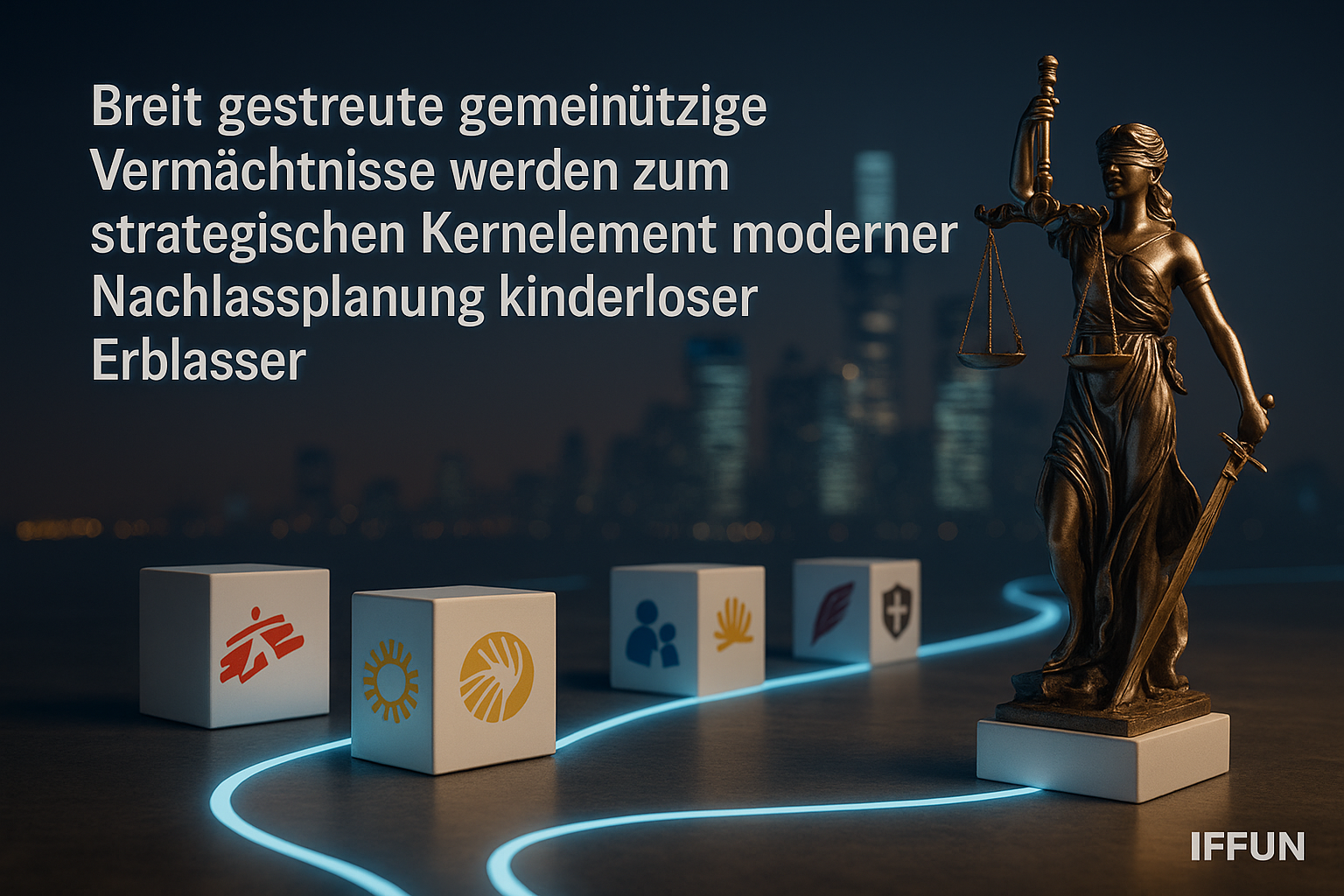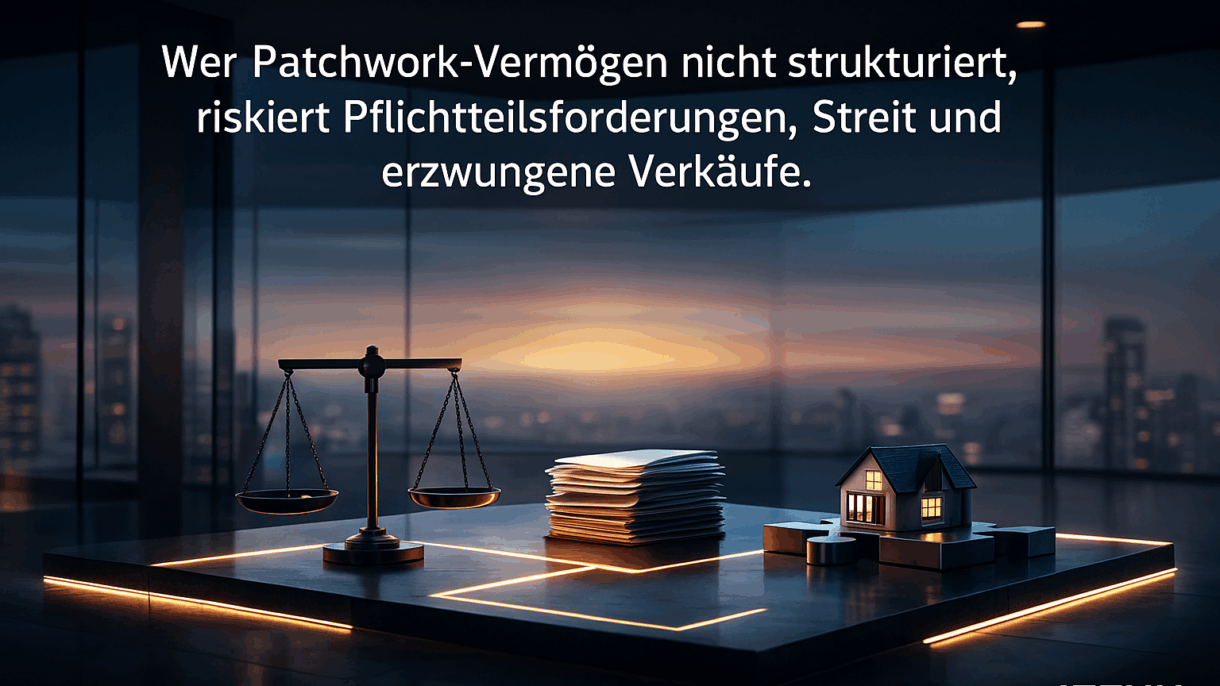
Die Zahl der Patchworkfamilien in Deutschland steigt seit Jahren, und mit ihr die Zahl komplexer Nachlasskonstellationen. Stirbt ein Vater, der erneut verheiratet war, stellt sich für viele Kinder aus erster Ehe die Frage, ob sie automatisch erben und welche Rechte sie tatsächlich haben. Für Finanzplaner sowie Nachfolge- und Estate-Planer gehört dieses Thema zu den anspruchsvollsten Bereichen der Mandatsbetreuung – insbesondere, wenn Vermögenswerte ungleich verteilt sind, hohe Immobilienwerte im Spiel sind oder sich familiäre Spannungen über Jahrzehnte aufgebaut haben. Der rechtliche Rahmen ist klar, doch die Praxis zeigt, dass Fehlannahmen über pflichtteilsrechtliche Ansprüche, Güterstände oder die Wirkung von Testamenten häufig zu erheblichen Konflikten führen.
Dieser Beitrag beleuchtet systematisch, wie die Erbfolge im Kontext einer Zweitehe funktioniert, welche rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen gelten und welche Maßnahmen Finanz- und Nachfolgeplaner im Mandat zwingend berücksichtigen müssen. Ergänzt wird die Analyse durch Beispiele, aktuelle Daten und Handlungsleitlinien für die Beratung anspruchsvoller Privat- und Unternehmermandate.
1. Gesetzliche Erbfolge und Testament: Grundlagen für Patchworkkonstellationen
Jede Nachlassplanung beginnt mit der Frage, ob ein Testament existiert oder nicht. Fehlt eine letztwillige Verfügung, greift automatisch die gesetzliche Erbfolge nach §§ 1924 ff., 1931 BGB. Die Konsequenzen sind vielen Mandanten nicht bewusst – insbesondere in Zweit- oder Drittehen.
Gesetzliche Erbfolge bei Kindern aus erster Ehe
Kinder aus früheren Ehen sind voll erbberechtigt, sobald kein Testament existiert. Sie stehen in der erbrechtlichen Ordnung gleichrangig mit Kindern aus späteren Ehen. Erben müssen somit miteinander kooperieren, selbst wenn familiäre Beziehungen belastet sind oder kein Kontakt mehr besteht.
Der neue Ehepartner (zweite Ehefrau) ist ebenfalls gesetzlicher Erbe. Die genaue Erbquote hängt dabei entscheidend vom Güterstand ab (siehe Kapitel 2).
Bedeutung eines Testaments in Zweitehen
Mandanten gehen häufig davon aus, dass der neue Ehepartner automatisch „alles erbt“. Genau das ist gesetzlich nicht vorgesehen und tritt nur ein, wenn ein Testament oder Erbvertrag dies ausdrücklich bestimmt.
Für Finanzplaner besonders relevant:
- In Patchworkfamilien sind Pflichtteilsansprüche praktisch nie vollständig vermeidbar.
- Pflichtteilsrechte wirken wie eine „Nachlasssteuer“, da sie liquide Mittel erfordern und oft Immobilienverkäufe erzwingen.
- Getrennte Vermögensmassen (z. B. Immobilien aus erster Ehe) erzeugen regelmäßig Konfliktzonen.
Die sorgfältige Klärung der Ausgangssituation ist daher essenziell.
2. Güterstände und ihre Auswirkungen auf die Erbquoten in Zweitehen
Die Erbquoten in Ehekonstellationen unterscheiden sich erheblich je nach Güterstand. Finanz- und Nachfolgeplaner müssen nicht nur den aktuellen Güterstand kennen, sondern auch mögliche Modifikationen durch Eheverträge, die gerade in zweiten Ehen häufiger vorkommen.
Zugewinngemeinschaft: Die „Werkseinstellung“ der Ehe
Leben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand, erbt der Ehepartner:
- ¼ als gesetzlicher Erbteil
- + ¼ als pauschaler Zugewinnausgleich
= ½ des Nachlasses
Die übrigen 50 % gehen an die Kinder zu gleichen Teilen.
Praxisbeispiel 1: Immobilienvermögen in Berlin
Ein Mandant verstirbt, besitzt eine selbstgenutzte Immobilie im Wert von 900.000 Euro sowie Bankvermögen von 100.000 Euro. Er hinterlässt eine Tochter aus erster Ehe und eine zweite Ehefrau.
Ohne Testament erhält die Ehefrau 500.000 Euro. Die Tochter erhält ebenfalls 500.000 Euro.
Die Folge: Die Ehefrau ist häufig gezwungen, die Immobilie ganz oder teilweise zu veräußern.
Gütertrennung: Gleichberechtigung zwischen Ehepartner und Kindern
In der Gütertrennung erbt der Ehepartner gleichrangig mit den Kindern.
- Bei einem Kind: 50/50
- Bei zwei Kindern: 1/3
- Bei drei oder mehr Kindern: 1/4
Praxisbeispiel 2: Unternehmerische Vermögenswerte
Ein Unternehmer lebt in zweiter Ehe mit Gütertrennung. Aus erster Ehe stammen drei Kinder.
Erbquote der Ehefrau: 1/4
Erbquote der Kinder insgesamt: 3/4
→ Ein Unternehmen wird häufig zum Zankapfel, wenn Kinder Minderheits- oder Mehrheitsanteile erhalten, obwohl die Ehefrau fortführen möchte.
Gütergemeinschaft: Selten, aber konfliktträchtig
Bei der Gütergemeinschaft wird der Nachlass aus dem hälftigen Gesamtgut plus dem alleinigen Vermögen des Verstorbenen gebildet. Die zweite Ehefrau hat hier regelmäßig die stärkste Position.
3. Pflichtteilsrecht: Schutzmechanismus für Kinder aus erster Ehe
Das Pflichtteilsrecht sichert nahen Angehörigen eine Mindestbeteiligung am Wert des Nachlasses – auch bei Enterbung. Gerade in Patchworkfamilien ist der Pflichtteil der häufigste Streitpunkt.
Pflichtteilsquote
Der Pflichtteil beträgt immer 50 % des gesetzlichen Erbteils.
Pflichtteil bei Enterbung
Wird die Tochter im Testament vollständig übergangen, kann sie ihren Pflichtteil verlangen:
- bei Zugewinngemeinschaft: gesetzlicher Erbteil wäre ¼ → Pflichtteil = 1/8
- bei Gütertrennung: bei einem Kind → gesetzlicher Erbteil = ½ → Pflichtteil = ¼
Praxisbeispiel 3: Pflichtteilsanspruch gegen die Stiefmutter
Ein Vater hinterlässt ein Testament, das seine zweite Ehefrau zur Alleinerbin macht. Die Tochter erhält nichts.
Nachlasswert: 600.000 Euro
Pflichtteil: 25 % = 150.000 Euro
→ Die Ehefrau muss liquide Mittel aufbringen, oft durch Kredite oder Teilverkäufe.
Dokumentationspflichten im Pflichtteilsverfahren
Nach § 2314 BGB besteht eine umfassende Auskunftspflicht der Erben. Finanz- und Estate-Planer sollten Mandanten darauf vorbereiten, dass Erben:
- lückenlose Vermögensübersichten liefern müssen
- Kontounterlagen herausgeben müssen
- Immobilienbewertungen erstellen müssen
- Schenkungen der letzten zehn Jahre offenlegen müssen
Versäumnisse führen regelmäßig zu Klagen.
4. Schenkungen, Vorausempfänge und ihre Auswirkungen in Zweitehen
Lebzeitige Vermögensübertragungen sind ein wichtiges Instrument der Nachfolgeplanung. In Patchworkfamilien wirken sie jedoch besonders stark auf die Pflichtteilsquote.
Anrechnung auf Pflichtteil
Schenkungen der letzten zehn Jahre lösen Pflichtteilsergänzungsansprüche aus (§ 2325 BGB).
Der Wert wird jährlich um 10 % abgeschmolzen („Abschmelzmodell“).
Praxisbeispiel 4: Immobilienübertragung an die Ehefrau
Ein Vater überträgt 2019 seine Immobilie auf die zweite Ehefrau. Er verstirbt 2025.
Anzurechnender Wert: 40 % des Immobilienwertes (da sechs Jahre vergangen sind).
→ Die Tochter kann Pflichtteilsergänzung geltend machen.
Für Finanzplaner bedeutet das: Jede größere Schenkung ist langfristig nachweispflichtig und kann Jahre später Konflikte auslösen. Eine detaillierte Dokumentation ist unverzichtbar.
5. Unternehmensnachfolge, Immobilien und Liquiditätsfallen
Patchworkkonstellationen betreffen oft Vermögenswerte mit geringer Liquidität: Unternehmensanteile, vermietete Immobilien, landwirtschaftliche Betriebe. Pflichtteilsrechte erzeugen hier besonders hohe Risiken.
Unternehmensnachfolge
Pflichtteilsansprüche können ein Unternehmen ernsthaft gefährden. Besonders kritisch:
- Minderheitsbeteiligungen für Stiefkinder
- Pflichtteilsbelastungen, die Liquidität absaugen
- unklare Stimmrechte im Gesellschaftervertrag
- fehlende Nachfolgeklauseln
Finanz- und Estate-Planer müssen zwingend die gesellschaftsvertraglichen Regelungen prüfen und mit dem Nachfolgekonzept verzahnen.
Immobilienwerte in angespannten Märkten
Steigende Immobilienwerte erhöhen Pflichtteilsquoten und führen häufiger zu Verkäufen.
Laut Statistischem Bundesamt sind die Immobilienpreise seit 2014 im Bundesdurchschnitt um mehr als 60 % gestiegen (Stand 2025).
Das zwingt Erben immer öfter zu Beleihungen oder Verkäufen, um Pflichtteile bedienen zu können.
6. Gestaltungsstrategien für Finanz- und Estate-Planer
Professionelle Nachfolgeplanung in Patchworkfamilien erfordert eine besonders sorgfältige Strukturierung.
Zentrale Gestaltungsinstrumente:
- Berliner Testament mit Pflichtteilsstrafklauseln
- Vor- und Nacherbschaft, wenn Vermögen innerhalb einer Linie bleiben soll
- Nießbrauch- oder Wohnrechtsgestaltungen
- Güterstandsmodifikation, z. B. modifizierte Zugewinngemeinschaft
- Erbverzichtsverträge gegen Abfindung
- Familiengesellschaften zur Bündelung von Vermögen
Pflichtteilsreduktion durch lebzeitige Planung
- gestreckte Schenkungen
- Freibetragsoptimierung alle 10 Jahre
- Einsatz von Familienpools zur Wertbegrenzung
- Unterbeteiligungen statt Eigentumstransfer
Gut strukturierte Planung reduziert Konflikte, schützt Liquidität und schafft klare Erwartungshaltungen – gerade in Zweitehen.
Anhang A – Handlungsschritte für Finanz- und Estate-Planer
| Schritt | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Familienstruktur vollständig erfassen (inkl. früherer Ehen, Stiefkinder, Adoptivkinder). |
| 2 | Güterstand prüfen und notariell bestätigen lassen. |
| 3 | Vermögensinventar und Bewertungsunterlagen anfordern. |
| 4 | Testament oder Erbvertrag prüfen – inkl. Klauseln für Zweitehen. |
| 5 | Pflichtteilsrisiken berechnen, besonders bei Immobilien und Unternehmen. |
| 6 | Schenkungen der letzten zehn Jahre dokumentieren und bewerten. |
| 7 | Gestaltungsoptionen entwickeln (Vor-/Nacherbschaft, Güterstandsmodifikation, Erbverzicht). |
| 8 | Liquiditätsplanung für Pflichtteile integrieren. |
| 9 | Gesellschaftsverträge mit Nachfolgeplan harmonisieren. |
| 10 | Regelmäßige Aktualisierung der gesamten Nachfolgeplanung. |
Anhang B – Rechtliche Quellen und Fundstellen
| Rechtsgrundlage | Inhalt |
|---|---|
| §§ 1922–2385 BGB | Allgemeines Erbrecht, gesetzliche Erbfolge, Pflichtteil, Erbverträge |
| § 1931 BGB | Erbrecht des Ehegatten |
| §§ 1363–1390 BGB | Güterstände: Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft |
| § 2314 BGB | Auskunftspflichten im Pflichtteilsrecht |
| § 2325 BGB | Pflichtteilsergänzung und Abschmelzmodell |
| Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) | Steuerliche Bewertung, Freibeträge, Unternehmensvermögen |
| Bewertungsgesetz (BewG) | Bewertung von Immobilien und Unternehmen |
Anhang C – Wichtigste Praxisimplikationen
- Kinder aus erster Ehe bleiben immer erbberechtigt – selbst bei schlechtem Verhältnis.
- In Zweitehen müssen Pflichtteile nahezu immer einkalkuliert werden.
- Güterstände beeinflussen Erbquoten drastisch und müssen klar dokumentiert sein.
- Vermögenswerte mit geringer Liquidität (Immobilien, Unternehmen) verschärfen Pflichtteilskonflikte.
- Schenkungen der letzten zehn Jahre sind zwingend transparent zu erfassen.
- Erbverzicht und Güterstandsmodifikation sind zentrale Werkzeuge zur Konfliktprävention.
- Nachfolgeplanung ist ein Zusammenspiel aus Familienrecht, Steuerrecht, Bewertungsrecht und Vermögensstruktur.
- Frühzeitige Gestaltung reduziert Liquiditätsrisiken und schützt Familienfrieden.